Bezüglich Wiederkäuerfütterung hat die Delegiertenversammlung (DV) der Bio Suisse mit 48 zu 38 Stimmen bei 6 Enthaltungen dem Gegenantrag des Vorstandes zugestimmt. Dieser sieht eine befristete Ausnahmeregelung für Wiederkäuerfütterung vor. Während fünf Jahren wird es den Mischfutterherstellern erlaubt, einen bestimmten Prozentsatz an ausländischen Knospe-Eiweisskomponenten einzusetzen.
Konkret sind das während drei Jahren (ab 1.1.24 bis 31.12.26) 10 Prozent ausländische Knospe-Eiweiss-Komponenten (gemessen an der Gesamtmenge Wiederkäuer-Kraftfuttermenge) und während zwei Jahren (1.1.27 bis 31.12.28) 5 Prozent ausländische Knospe-Eiweisskomponenten (gemessen an der Gesamtmenge Wiederkäuer-Kraftfuttermenge).
«Unter Umständen die Konsequenzen ziehen»
Gleichzeitig hat die DV damit den Grundsatz bestätigt, der an der Delegiertenversammlung im April 2018 beschlossen worden ist: Knospe-Wiederkäuer dürfen nur Schweizer Futter fressen und dürfen nur 5 Prozent Kraftfutter fressen. Ab 2028 soll es also sein, dass wieder gar kein Soja mehr in die Schweiz importiert werden darf.
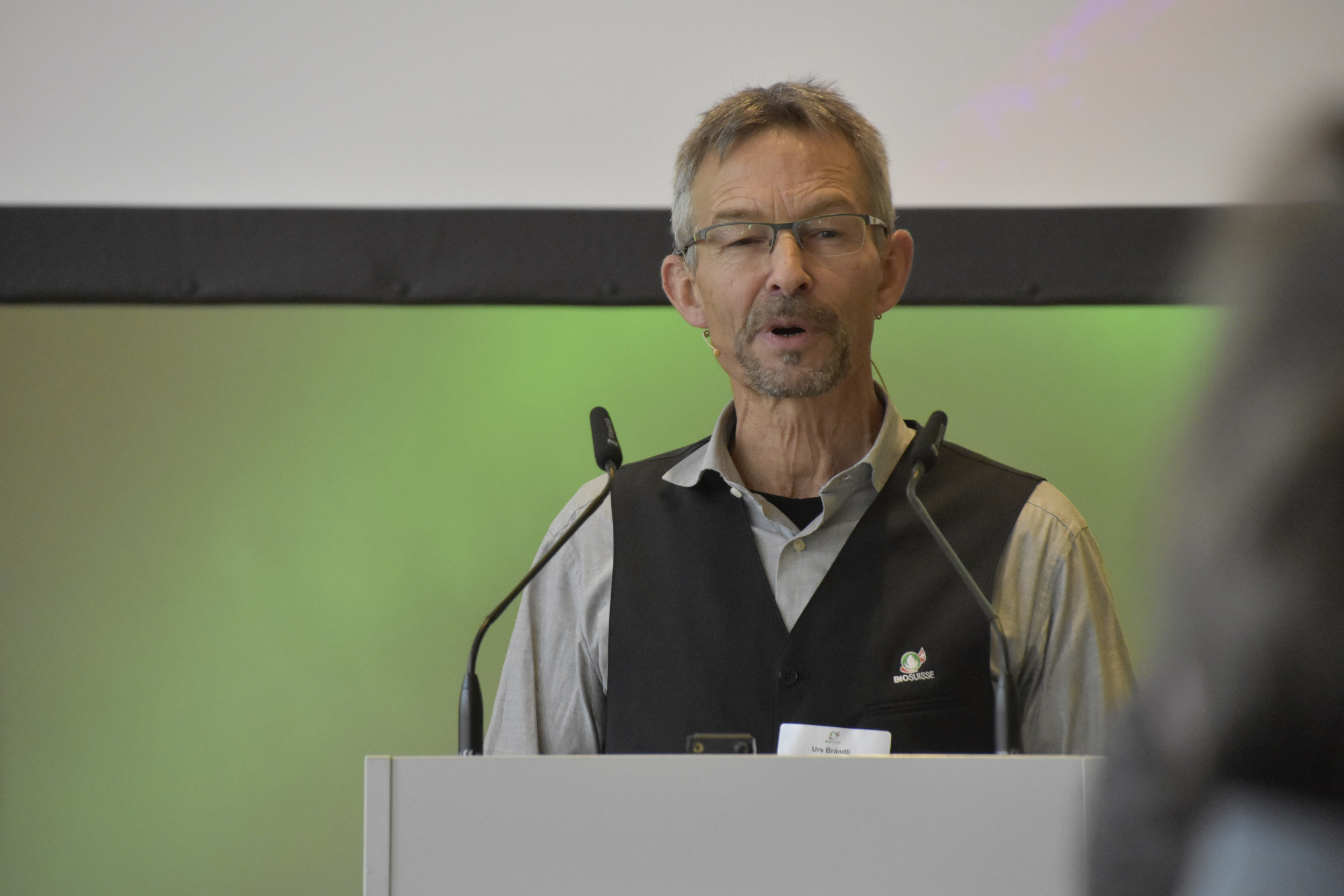
Bio-Suisse-Präsident Urs Brändli war es wichtig, dass der Grundsatz "100% Schweizer Futter für Wiederkäuer" nicht angetastet wird.
Daniel Salzmann
Bio-Suisse-Präsident Urs Brändli kommentierte das Abstimmungsresultat wie folgt: «Wir kommen jetzt den stark betroffenen Betrieben mit einer befristeten Ausnahmebewilligung entgegen. Es braucht jetzt aber auch die Bereitschaft der betroffenen Betriebe, sich darauf einzulassen. Wenn jemand sagt, ich will an meinem Zuchtziel festhalten, dann muss er jetzt unter Umständen die Konsequenzen ziehen. Das wäre sehr schade. Denn wir haben sehr viele gute Beispiele, an denen wir zeigen können, wie man es anpacken kann.»
Vorstand machte Gegenantrag
Genau vor Austritten aus dem Bio-Landbau hatten vorher Vertreter von Bio Jura und von Bio Grischun gewarnt. Der Verband von Bio Grischun war es gewesen, der ursprünglich die Diskussion angestossen hatte. Einen Antrag hatte dann Bio Ostschweiz gestellt, die für den Winter 2023/2024 eine befristete (nicht näher ausgeführte) Regelung für den Import von Eiweissträgern (es geht vor allem ums Soja) zulassen wollte. Bio Suisse, so führte es Brändli aus, wollte aber nicht etwa mit einem weiten Öffnen der Türe für Importe die laufenden Anstrengungen zum Ausbau der inländischen Körnerleguminosen-Produktion gefährden.
Auch war laut Brändi eine nur sechsmonatige Bewilligungsfrist für die Importeure und die Futtermühlen kaum umsetzbar. Darum hat eine vom Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe den oben genannten Gegenantrag zum Antrag von Bio Ostschweiz formuliert, woraufhin Bio Ostschweiz ihren Antrag schon letzte Woche, noch vor der DV, zurückgezogen hat. Laut Brändli ist die Betroffenheit je nach Region stark unterschiedlich. Es sei deutlich gewesen, dass jetzt vor allem Kritik aus Regionen laut werde, wo es eine grosse Viehzuchttradition gebe. Wieviel 10 Prozent alles Wiederkäuerkraftfutters ist, die nun wieder importiert werden dürfen, wieviel das nützen sollte, wieviel mehr Leistung Milch dieses wertigere Kraftfutter bringen sollte, dazu gab es an der DV seitens des Vorstandes keine Informationen.

Peter Schweizer, Delegierter von Bio Ostschweiz, sagte: "An der Basis ist die Stimmung sehr aufgeheizt."
Daniel Salzmann
Für die Ostschweizer sprach kurz Peter Schweizer, Delegierter von Bio Ostschweiz. Er wollte mit einem kurzen Statement aufzeigen, «was bei uns abgeht. An der Basis ist die Stimmung aufgeheizt. Wir wollten darum mit dem Antrag für eine befristeten Eiweissimport noch im laufenden Winter Druck aus dem Kessel nehmen.»
Kurzfristig eingereichter Gegenantrag von Bio Jura
Einen Tag vor der DV hatte Bio Jura seinerseits einen Gegenantrag eingereicht. Denn die Mitgliedorganisation war mit dem Gegenantrag des Vorstandes unzufrieden. Tommy Herwig, Delegierter der Bio Jura, stellte diesen vor den Delegierten vor. Er umfasste erstens eine schnelle Regelung für die aktuellen Probleme: Für das Jahr 2024 sollten wie beim Antrag des Vorstandes 10 Prozent des Wiederkäuerkraftfutters importiert werden dürfen. Zweitens sollte aber der Vorstand an der Frühjahrs-DV 2024 Vorschläge für eine Anpassung der Weisungen machen, die so sein sollten, dass möglichst viele Mitglieder der Bio Suisse mitmachen und zu denen in den Unterlagen stand: «Es geht in erster Linie darum, die Bedingungen in den Bergregionen besser zu berücksichtigen und eine grössere Flexibilität bei der Nutzung von Kraftfutter und beim Import von Grundfutter anzuvisieren.»

Tommy Herwig, Delegierter von Bio Jura, forderte eine erneute Grundsatzdiskussion darüber, ob alle Eiweisskomponenten aus der Schweiz stammen müssen.
Daniel Salzmann
Drittens solle die Arbeitsgruppe Wiederkäuerfütterung ihre Arbeit fortsetzen und Daten sammeln zu: Auswirkung des Proteingehalts im Futtermittel auf die Gesundheit und Rentabilität der Knospe-Milchviehherden, eine Umfrage bei den Milchproduzentinnen und -produzenten machen, bei welcher mindestens 95 Prozent mitmachen und die beratende Begleitung stärken und auch finanziell unterstützen. Es lief also letztlich auf eine erneute Grundsatzdiskussion der Wiederkäuerfütterung und auf eine Aufweichung des Beschlusses von 2018 hinaus.
Herwig: «Unzufriedenheit ist sehr gross»
Herwig sagte: «Wir sollten uns einer Grundsatzdiskussion nicht verschliessen.» Man habe 2018 einen moralisch-visionären Entscheid getroffen, aber habe ihn auf unzureichender Datengrundlage getroffen. So habe man die Folgen der Richtlinienänderung falsch eingeschätzt. Man solle doch nicht jetzt schon wieder eine Entscheidung treffen, bevor man mehr Daten habe, bevor die Forschung Erkenntnisse gewonnen habe. Herwig zitierte eine Umfrage der Mitgliedorganisation Progana.
«Nach unseren Daten ist die Unzufriedenheit sehr gross!» Bei Progana hätten ein Drittel von 370 Milchproduzenten bei einer Umfrage mitgemacht. 62% hätten gesagt, dass sie mit dem Gehalt des Kraftfutters nicht zufrieden sind. 58% seien mit dem Milchpreis nicht zufrieden. 46% wünschten sich eine Anpassung der Richtlinien. 32% dächten darüber nach, aus dem Biolandbau auszusteigen oder seien sogar schon ausgestiegen. «Die aktuelle Situation könnte also dazu führen, dass wir Hunderte von Milchbauern verlieren könnten.
Die Angst, eine schwierige Zeit vor den Medien zu verbringen, darf nicht über der Zukunft dieser Hunderten von Betrieben gestellt werden. Wir müssen unbedingt die Bedürfnisse dieser Betriebe berücksichtigen.» Auch Romain Beuret von Bio Jura machte sich für den Gegenantrag von Bio Jura stark. Er sagte auch, dass das Risiko der Nichteinhaltung der Richtlinien steigen könnte, was einen grossen Skandal geben könnte. Auf diesen Gedanken reagierte Urs Brändli mit aller Deutlichkeit: Wer sich wissentlich nicht an die Fütterungsrichtlinien halte, begehe einen doppelten Betrug: einerseits an seinen Berufskollegen, die sich an die Bio-Richtlinien hielten, andererseits an den Konsumenten.
Brändli: «Knospe muss den anderen 20 Jahren voraus sein»
Die Voten von Herwig und Beuret provozierten Brändli zu einer deutlichen Stellungnahme für den Gegenantrag des Vorstandes. Brändli erinnerte an den Entscheid der DV von 2018: «Dieser Beschluss bedeutet, dass die Knospe der gesamten Schweizer Milchproduktion rund 20 Jahre voraus ist. Lest das Strategiepapier des Bundes für 2050, da ist die Feed-Food-Konkurrenz aus den Ackerflächen ein grosses Thema.» Damit meint Brändli, dass Früchte vom Acker aus Ressourcen- und Umweltüberlegungen möglichst nicht verfüttert werden sollten (Feed), sondern direkt vom Menschen gegessen werden sollten (Food).
«Das wird künftig in der Schweiz ohnehin zum Thema. Wenn die Knospe nicht um Jahre voraus ist, haben wir ein Problem, unsere Mehrwerte und unseren Mehraufwand einigermassen fair entschädigt zu bekommen», führte Brändli aus. Im Jahr 2022 haben man einen Mehrpreis für die Bio-Milch in der Höhe von mehreren Rappen erhalten, weil man eben neu versprochen habe: Nur Futter aus der Schweiz (tatsächlich machte Bio Suisse dazu eine grosse Kampagne in der ganzen Schweiz und auch auf digitalen Kanälen) und nur noch 5 Prozent Kraftfutter. Wenn man im Frühling 2024 wieder alles ändern würde und etwa wieder uneingeschränkt Luzerne importiert werden dürfte, könnte es laut Brändli sogar Regressforderungen an die Adresse von Bio Suisse geben, etwa von einheimischen Luzerne-Produzenten.
Pfister: «Hausaufgaben nicht gemacht!»
In der Folge entspann sich eine vielfältige Diskussion. Christof Meili, Delegierter der Biofarm, bekannte, wie von den Jurassiern erwünscht, dass er selbst nicht Milchproduzent ist, sondern potenzieller Futterlieferant. Er machte sich für eine Lenkungsabgabe auf dem Import von Eiweissträgern stark, von welcher der Vorstand in den Unterlagen leider nur vage spreche. Denn sonst gebe es unerwünschte Marktverwerfungen. Brändli sagte, die Fachgruppe Ackerbau werde die Details diskutieren, eine Abgabe sei vorgesehen.

Thomas Pfister, Delegierter von Bio Zug, sagte sinngemäss, wer jetzt als Betriebsleiter bei der Fütterung ein Problem habe, habe seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Daniel Salzmann
Thomas Pfister von Bio Zug betonte, dass die Delegierten die Richtlinienänderung von 2018 ohne Gegenstimme angenommen hatten. Er wandte sich der Sache nach gegen beide Anträge, sondern für ein uneingeschränktes Festhalten am Beschluss von 2018, also gegen eine befristete Ausnahmebewilligung. «Der Prozess begann schon vor 2018. Seither gab es fünf Jahre Übergangsfrist. Man hatte Zeit, sich darauf einzustellen. Wenn wir jetzt noch einmal mehrere Jahre Zeit geben, bringt das nicht.»
Es wäre vielmehr ein falsches Signal, etwa an die Legehennenbranche, die dann sonst auch sagen werde, sie brauche bezüglich des Vermeidens des Kükentötens noch mehr Zeit. Pfister sagte, viele Milchproduzenten hätten sich angepasst, auch er selbst, der er nach wie vor melke. «Hausaufgaben nicht gemacht!» lautete sein Schlusswort, das mit Applaus quittiert wurde. Vorher hatten die Jurassier für die gegenteilige Meinung allerdings auch Applaus geerntet.
Riatsch: «Wenn einige Bio verlassen, hat das Folgen für alle»
Fadri Riatsch von Bio Grischun erklärte, die Delegierten der Bio Grischun hätten gestern Abend noch den Antrag von Bio Jura besprochen und hätten beschlossen, ihn zu unterstützen. «Es besteht Handlungsbedarf. Wir müssen uns eingestehen, dass der damalige Entscheid vielleicht auch zu weit ging. Die Rückmeldungen aus unseren Talschaften bestärken uns, wie ernst wir das Thema nehmen müssen.» Im Berggebiet sei es noch herausfordernder als im Talgebiet, Biomilch zu produzieren.
Er verwies darauf, dass es im Kanton Graubünden Täler geben, in denen beispielsweise Käsereien oder Alpen Einheiten bilden, die sofort Probleme bekommen oder bekämen, wenn einige Produzenten die Knospe verlassen oder verliessen. «Wenn einige aussteigen, hat das Folgen für alle!», rief er in den Saal. Die wirtschaftlichen Folgen des Entscheids von 2018 müssten nochmals angegangen werden, die Grundlagen müssten neu erarbeitet werden, so Riatsch. Es brauche nochmals eine Grundsatzdiskussion.
Scherer: «Besser Energie in Verbesserung des Grundfutters stecken»
Mischa Scherer, Emmi-Direktlieferant aus Lengnau BE und Delegierter von Bio Bern, sieht es anders als Riatsch. Er meinte: «Das Geld, das wir jetzt nochmals ins Kraftfutter stecken wollen, sollten wir besser in Hofdüngeraufwertung, Wiesenaufwertungen und in das bessere Schliessen der Kreisläufe auf unseren Höfen stecken. Dort sollten wir unsere Energie einsetzen. Mit ein bisschen mehr Eiweiss können wir schlechtes Grundfutter nicht wettmachen.» Noch werde das Potenzial für Grundfutter noch nicht überall ausgeschöpft.
Er stamme aus der Ostschweiz und sei dort auch regelmässig unterwegs, da sehe er teilweise massiv schlechte Grünlandbestände. Wenn man pro Hektar 500 Kilogramm qualitativ gutes Grundfutter ernten könnte, würde das viel ausmachen, man solle sich das vorstellen. «Wenn wir uns auf die Verbesserung des Grundfutters konzentrieren, sind wir stärker und glaubwürdiger unterwegs», so Scherer.
Vögele: «Zeit geben, um Steine aus dem Weg zu räumen»
«Ich wehre mich dagegen, dass man darüber nur urteilen sollte, wenn man die Hände am Euter hat, wie es geheissen hat», sagte Ruedi Vögele, Delegierter von Bio Zürich-Schaffhausen und Präsident der Fachgruppe Ackerkulturen. Beim Kükentöten hätten auch alle mitentschieden, obwohl nicht alle Hühner hätten. Er verstehe vollauf, dass es Betriebe gebe, die Probleme hätten. Aber auch die Schweinebetriebe gingen den Weg mit 100% Bio-Futter und würden das umsetzen. «Dieser Weg ist keine Autobahn. Darauf liegen Steine, die gilt es wegzuräumen.» Vielleicht müsse man einigen noch Zeit geben, die Steine wegzuräumen. Darum stehe er völlig hinter dem Antrag des Vorstandes.
Man schaffe es im Moment nicht, die geforderten Mengen an Eiweissträgern in der Schweiz zu produzieren, vielleicht werde man aber in fünf Jahren schon ein Stück weiter sein. Wenn man aber den Import wieder im Grundsatz oder komplett freigeben sollte, wäre das sehr unglaubwürdig. «Wir ärgern uns auch, wenn die Konsumenten am Wochenende ins Ausland einkaufen gehen. Wir Bioproduzenten würden uns unglaubwürdig machen, wenn wir grundsätzlich zum Import zurückgingen.»
Der Gegenvorschlag des Vorstandes sage ihm sehr zu. Dieser hält ja eben am Grundsatz 100% Schweizer Futter fest und will diesen ab Grundsatz ab 2029 auch wieder konsequent durchsetzen. Konrad Meier, Bioring Appenzellerland, sagte in Richtung der Jurassier, man könne unmöglich im Frühling 2024 entscheiden, wenn man die Hochschule Hafl involvieren wolle und eine Umfrage wolle, bei welcher 95% der Milchviehbetriebe mitmachen würden.
Gregori: «Bio-Käsereien haben ein Problem, wenn nur 1 Biobauer wegfällt»
Claudio Gregori von Bio Grischun warb ebenfalls für den Antrag von Biojura. Er sagte: «Wir haben immer gesagt, dass wir die 5% Kraftfutterobergrenze nicht antasten wollen. Es geht um Käsereien, die unter 1 Million Kilogramm Milch verarbeiten und die bereits ein Problem haben, wenn ein Milchproduzenten mit 100'000 kg Biomilch wegfällt. Wenn einige gehen, betrifft dies auch die anderen im Biobereich. Bei den Käsereien geht es um Topprodukte, die Coop seit Jahren im Sortiment hat.»
Betreffend der Steine im Weg, die Ruedi Vögele erwähnt hatte, sagte Gregori, der Anbau von Eiweisskomponenten in der Schweiz werde in der Schweiz kaum grösser sein als heute, da gebe es zuviele regionale und klimatische Probleme. Das letzte Votum stammte von Jonas Lichtenberger von der Schweizer Bergheimat. Er sei einer, der wirklich die Hand am Euter habe, er melke nämlich seine Kühe von Hand, und zwar seit dreissig Jahren ohne Kraftfutter. Man könne gerne ihn als Beispielbetrieb besuchen kommen.

Die Abstimmungen gingen relativ knapp aus. Der Vorstand fand mit seinem Antrag eine Mehrheit.
Daniel Salzmann
Relativ knapper Ausgang der zwei Abstimmungen
Dann ging es zur Abstimmung. Die Spannung im Saal war spürbar gross. Zuerst wurden die Gegenanträge des Vorstandes und von Biojura einander gegenübergestellt. Da bekam der Antrag des Vorstandes 39 Stimmen, derjenige von Biojura 33 Stimmen. Daneben stand eine hohe Zahl von Enthaltungen, 17 an der Zahl.
Am Ende kam der Gegenantrag des Vorstandes alleine zur Abstimmung. Ja hiess also Zustimmung zu einer befristeten Ausnahmeregelung für den mengenmässig beschränkten Soja-Import während fünf Jahren, Nein hiess, dass man bei der Regelung von 2018 bleiben will (100% Schweizer Futter, maximal 5% Kraftfutter), ohne dass jetzt eine Ausnahme gemacht werde. 48 stimmten für den Antrag des Vorstandes, 38 dagegen, 6 enthielten sich.




Das geht nicht mehr auf.
Und dem, dem die richtlinien noch nicht weit genug gehen, darf ja gerne zu demeter wechseln.
Übrigens geht das mit dem reduzierten Eiweissgehalt im Kraftfutter problemlos. Ich mache das seit Jahrzehnten und habe ökonomisch sehr gute Zahlen.
Jeder Biobauer, der mit der aktuellen Situation der Regeln nicht zufrieden ist, muss sich fragen ob er nun Viehzüchter oder Milchbauer ist. Ich glaube, dass bei den allermeisten das Milchgeld wesentlich mehr ausmacht, als der Zuchtviehverkauf.
Schliesslich fördert ein restriktives Importregime den einheimischen Futterbau! Dort liegt tatsächlich noch viel brach.