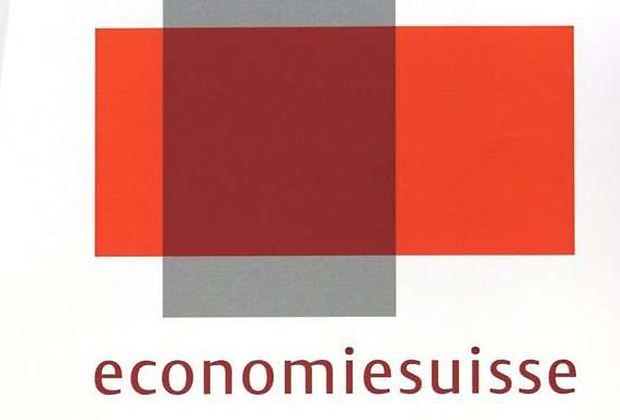Ihren Vorgängern wurde einst Bundesrats-Status attestiert. Die designierte Economiesuisse-Direktorin Monica Rühl übernimmt einen Wirtschaftsdachverband, der heute nur noch einen Schatten seiner selbst darstellt.
Die jüngste Pleite ist keine zwei Wochen alt: Trotz einer Millionenkampagne verlor Economiesuisse ein Jahr nach dem Ja zur Abzockerinitiative auch den Kampf gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP. Abstimmungspannen, Richtungskämpfe und personelle Querelen prägen seit Jahren das Bild eines Verbandes, der lange Zeit die erste Geige in der schweizerischen Wirtschaftspolitik spielte.
Aus Fusion hervorgegangen
Economiesuisse war im Jahr 2000 als Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft aus einer Fusion des Schweizerischen Handels- und Industrievereins (SHIV), kurz Vorort genannt, und der wf, der Gesellschaft zur Förderung der schweizerischen Wirtschaft, hervorgegangen.
Der Vorort vereinigte alle wichtigen Verbände von Industrie, Handel und Dienstleistung, die kantonalen Industrie- und Handelskammern sowie weitere Organisationen. Er hatte rund 130 Mitglieder, deren Interessen er in der schweizerischen Politik vertrat.
Noch bis in die achtziger Jahre galten seine Direktoren als «achter Bundesrat»
Die 1942 gegründete Wirtschaftsförderung (wf) vertrat als Organisation der Privatwirtschaft marktwirtschaftliches Gedankengut gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. 1999 gehörten ihr rund 2500 Unternehmungen an. Da sich die Aufgaben von wf und Vorort teilweise überschnitten, wurde schon lange eine Fusion überlegt. In den neunziger Jahren, angesichts der europäischen Integration und der Globalisierung, erschien ein gemeinsames Auftreten der Wirtschaft gegenüber Politik und Öffentlichkeit nötiger den je.
Spaltpilz greift um sich
Ursprünglich war ein Super-Wirtschaftsverband geplant, dem auch der Arbeitgeberverband angehören sollte. Dieser entschied sich 1999 aber für den Alleingang. Immer öfter kollidierten bei Economiesuisse die Interessen der global orientierten Banken-, Grossindustrie- und Pharmabranche mit jenen der binnenorientierten Branchen.
2006 eskalierte der Richtungsstreit. Swissmem-Präsident Johann Schneider-Amman, der heutige Bundesrat, kritisierte damals scharf die Spitzenlöhne von Top-Managern wie UBS-Chef Marcel Ospel, mit dem er im Economiesuisse-Vorstand sass.
Economiesuisse unter Druck
Swissmem, die Arbeitgeber der Maschinenindustrie, und auch der Baumeisterverband kündigten vorsorglich die Mitgliedschaft. Dem damaligen Präsidenten Gerold Bührer gelang es, den Riss mit einer Strategiereform zu kitten. Unter seinem Nachfolger Rudolf Wehrli machte sich erneut der Spaltpilz breit.
Anfang 2013 gab die Branchenorganisation der Uhrenindustrie (FH) ihren Austritt bekannt. Hintergrund war der Streit um das Label «Swiss Made». Swatch-Chef Nick Hayek kritisierte die «Abgehobenheit der Economiesuisse-Funktionäre» und deren Distanz zu den echten Problemen des Werkplatzes Schweiz. Im November zog die FH den Austritt zurück.
Köpferollen nach Abstimmungsdebakel
Erneut ins Schlingern geriet Economiesuisse wegen der Abzockerinitiative. Der Verband stellte sich an die Spitze der Gegner. Das Stimmvolk aber hiess im März 2013 die Initiative mit 67,9 Prozent deutlich gut. Economiesuisse hatte für die Abstimmung ein Budget von rund 8 Mio. Franken.
In ein schlechtes Licht geriet der Verband dabei insbesondere, als bekannt wurde, dass ein Werbebüro Studenten für Online-Kommentare gegen die Initiative besoldete. Präsident Wehrli, kein Jahr im Amt, und Geschäftsführer Pascal Gentinetta traten im Sommer zurück. Auch die Economiesuisse-Kampagnenchefin nahm Ende 2013 den Hut.
Auf Wehrli folgte der ehemalige Axpo-Chef Heinz Karrer. Zusammen mit Gentinettas interimistischem Nachfolger Rudolf Minsch musste er mit dem Ja zur Zuwanderungs-Initiative eine erste krachende Niederlage hinnehmen.