Artikel werden durchsucht.
Politik & Wirtschaft
Agrarwirtschaft
Dieser Gruyère ist erneut Weltmeister
An den World Cheese Awards, die am Donnerstag in Bern stattfanden, hat ein Gruyère AOP aus der Bergkäserei Vorderfultigen BE den Gesamtsieg…
Tiere
Milchvieh
Sie vergleichen die Liegematten mit jenen aus dem Turnunterricht
Als Michael Rusterholz in seinem Milchviehstall eine Erweiterung mit Aussenboxen plante, war für ihn klar, dass dort Tiefboxen mit Stroh…
Land & Leute
Leben & Geniessen
Wie aus der Rübe Schweizer Zucker wird
Rund 230’000 Tonnen Zucker stammen jährlich aus Schweizer Zuckerrüben – und landen später in Schokolade, Joghurts, Getränken oder als…
Aktuelle
Meistgelesen
Vogelgrippe: Spanien verhängt Stallpflicht
14.11.2025
Dieser Gruyère ist erneut Weltmeister
13.11.2025
Bauern mit Tieren geraten unter Druck
13.11.2025
D: Geflügelpest bringt Labore an Anschlag
13.11.2025
Lemken stellt Geschäftsführung neu auf
13.11.2025
Neuer Weltrekord beim Häckseln
13.11.2025
GB: Lebensmittelproduktion schrumpft
13.11.2025
Der begehrte Titel geht ins Safrandorf
13.11.2025
Vogelgrippe-Fall auch am Zürichsee
13.11.2025
Wie aus der Rübe Schweizer Zucker wird
13.11.2025
Diese Kühe kommen den Zuchtzielen sehr nahe
13.11.2025
Polarlichter im Doppelpack
13.11.2025
Zivilschutz: Ab 2026 gilt längere Dienstzeit
13.11.2025
Ukraine: Agrarexporte weiter gesteigert
13.11.2025
Meistkommentiert
Landtechnik
Firmen & Personen
Neuer Weltrekord beim Häckseln
Der deutsche Landtechnikhersteller Claas hat einen neuen Weltrekord bei der Futterernte aufgestellt. Mit dem…
13.11.2025 16:00
Politik & Wirtschaft
Agrarwirtschaft
Solutions statt Treuhand: TSM hat neuen Namen
Die TSM Solutions GmbH tritt mit neuem Namen und Logo am Markt auf. Mit diesem Schritt soll die strategische…
13.11.2025 14:40
Regionen
Nordwestschweiz
«Das ist kein Bauernhof mehr»
Der Veterinärdienst hat in Ramiswil SO 120 Hunde eingeschläfert und 42 Pferde beschlagnahmt. Landwirte aus der…
13.11.2025 08:40
Regionen
Bern
Diese Kühe kommen den Zuchtzielen sehr nahe
85 Kühe aus dem Oberland-Ost wurden für den 12. Jungfraufinal aufgeführt. Die junge Red Holstein deForme Spirit…
13.11.2025 12:00
Tiere
Geflügel
Vogelgrippe-Fall auch am Zürichsee
Bei einer Graugans in Männedorf ZH ist das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Es ist bereits der zweite Fall in…
13.11.2025 13:20
Regionen
Südostschweiz
Unerwünschtes Verhalten: Zwei Wolfsrudel dürfen geschossen werden
Die Wolfsrudel Muchetta um Bergün und Sinestra im Raum Scuol können aufgrund von «unerwünschtem Verhalten gegenüber…
13.11.2025 16:40
Bilder der Woche









Das Wetter heute in
Umfrage

Setzt Ihr auf Natursprung?
39.3 %
Ja, ausschliesslich
16.9 %
Nein, nie
22.5 %
Ja, je nach Kuh
12.4 %
Ja, als letzte Chance (wenn KB mehrfach erfolglos)
9 %
Manchmal
Teilnehmer insgesamt 89
Bekanntschaften
Suchen Sie Kollegen und Kolleginnen für Freizeit und Hobbies? Oder eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner?
Dossier
Regionen
Regionen
Südostschweiz
Bauern mit Tieren geraten unter Druck
Nadine Trottmann vom Schweizer Bauernverband präsentierte dem Bioring Appenzellerland alarmierende Zahlen.
…
13.11.2025 18:40
Regionen
Südostschweiz
Unerwünschtes Verhalten: Zwei Wolfsrudel dürfen geschossen werden
Die Wolfsrudel Muchetta um Bergün und Sinestra im Raum Scuol können aufgrund von «unerwünschtem Verhalten gegenüber…
13.11.2025 16:40
Regionen
Westschweiz
Der begehrte Titel geht ins Safrandorf
Rund zweihundert Ziegen aus dem Oberwallis standen in der Mehrzweckhalle in Visp VS im Rampenlicht. Der Höhepunkt…
13.11.2025 14:00
Regionen
Bern
Diese Kühe kommen den Zuchtzielen sehr nahe
85 Kühe aus dem Oberland-Ost wurden für den 12. Jungfraufinal aufgeführt. Die junge Red Holstein deForme Spirit…
13.11.2025 12:00
Politik & Wirtschaft
Politik & Wirtschaft
International
«Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit den USA»
Wirtschaftsminister Guy Parmelin zeigte sich nach dem Besuch in Washington und den Gesprächen über die Zölle…
14.11.2025 06:40
Politik & Wirtschaft
Agrarwirtschaft
Dieser Gruyère ist erneut Weltmeister
An den World Cheese Awards, die am Donnerstag in Bern stattfanden, hat ein Gruyère AOP aus der Bergkäserei…
13.11.2025 20:36
Politik & Wirtschaft
International
D: Geflügelpest bringt Labore an Anschlag
Die sich weiterhin rasant ausbreitende Geflügelpest stellt eine grosse Belastung für die zuständigen deutschen…
13.11.2025 18:00
Politik & Wirtschaft
International
GB: Lebensmittelproduktion schrumpft
Im Vereinigten Königreich droht ein massiver Rückgang der Lebensmittelproduktion. Eine neue Studie warnt, dass bis…
13.11.2025 15:20
Markt & Preise
Markt & Preise
Marktpreise
Die aktuellen Marktpreise
Auf schweizerbauer.ch werden am Freitag jeweils die aktuellen Schlachtviehpreise publiziert.
Die aktuellen…
07.11.2025 17:20
Markt & Preise
Marktmeldungen
Walliser Wein für knapp 3 Franken
Aldi sorgt erneut für Aufsehen: Nach dem Brot für 99 Rp. bietet der Discounter nun ein Dôle du Valais AOC für…
12.11.2025 16:00
Markt & Preise
Marktmeldungen
Fenaco erhöht Lohnsumme – Kritik von Gewerkschaften
Der Agrarkonzern erhöht die Gesamtlohnsumme für das Jahr 2026 um 1,0 Prozent. Die Gewerkschaften Unia und Syna…
12.11.2025 10:40
Markt & Preise
Marktmeldungen
Coop setzt auf Prix-Garantie-Offensive
Der Schweizer Detailhandel steckt mitten im intensiven Preiskampf. Laut blick.ch hat Coop darauf mit einer gezielten…
10.11.2025 20:36
Pflanzen
Pflanzen
Pflanzenschutz
Glyphosat-Klagen: Bayer muss Milliarde zurücklegen
Die Spätfolgen der Monsanto-Übernahme für Bayer reissen nicht ab. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern muss wegen…
12.11.2025 14:40
Pflanzen
Ackerbau
Feldtage 2026 an neuem Standort
Vom 10. bis 12. Juni 2026 wird Kirchberg BE zum Zentrum des Schweizer Ackerbaus. Die Feldtage 2026 präsentieren auf…
12.11.2025 14:20
Pflanzen
Ackerbau
Mit umstrittener Methode Ertrag steigern
Die Kinsey-Methode ist umstritten. In Versuchen zeigt sie keine Effekte. Jan Richardt aus Deutschland hat aber…
12.11.2025 14:00
Pflanzen
Pflanzenschutz
Ackerfuchsschwanz noch vor dem Winter bekämpfen
Das Winterbehandlungsverbot steht bevor. Vorher gibt es im Raps noch die Chance, chemisch gegen ein Problemungras…
12.11.2025 07:20
Tiere
Tiere
Tiergesundheit
Vogelgrippe: Spanien verhängt Stallpflicht
Spanien hat angesichts der Ausbreitung der Vogelgrippe eine landesweite Stallpflicht verhängt. Seit Montag galt…
14.11.2025 06:00
Tiere
Milchvieh
Sie vergleichen die Liegematten mit jenen aus dem Turnunterricht
Als Michael Rusterholz in seinem Milchviehstall eine Erweiterung mit Aussenboxen plante, war für ihn klar, dass dort…
13.11.2025 19:58
Tiere
Milchvieh
115 Produzentinnen und Produzenten für gute Milch geehrt
Immer im Herbst vergeben die Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost (VMMO) die Auszeichnung «20 Jahre Gute Milch». Im…
13.11.2025 19:20
Tiere
Geflügel
Vogelgrippe-Fall auch am Zürichsee
Bei einer Graugans in Männedorf ZH ist das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Es ist bereits der zweite Fall in…
13.11.2025 13:20
Landtechnik
Landtechnik
Firmen & Personen
Lemken stellt Geschäftsführung neu auf
Der Landtechnikhersteller Lemken stellt seine Geschäftsführung neu auf. Künftig bringen drei Führungskräfte…
13.11.2025 17:20
Landtechnik
Firmen & Personen
Neuer Weltrekord beim Häckseln
Der deutsche Landtechnikhersteller Claas hat einen neuen Weltrekord bei der Futterernte aufgestellt. Mit dem…
13.11.2025 16:00
Landtechnik
Ausstellungen Landtechnik
Agritechnica 2025: Wir geben euch einen Einblick
Die Agritechnica 2025 hat ihre Tore geöffnet. Vom 9. bis 15. November trifft sich in Hannover die internationale…
12.11.2025 10:00
Landtechnik
Firmen & Personen
Claas präsentiert neue Arion-6-Baureihe
Auf der Agritechnica präsentiert Claas die Arion 6 Cmatic-Baureihe mit neuen Design und neuen Komfortmerkmalen. Zum…
10.11.2025 18:00
Land & Leute
Land & Leute
Leben & Geniessen
Wie aus der Rübe Schweizer Zucker wird
Rund 230’000 Tonnen Zucker stammen jährlich aus Schweizer Zuckerrüben – und landen später in Schokolade, Joghurts,…
13.11.2025 12:40
Land & Leute
Leben & Geniessen
«Den richtig guten Käse findet man leicht»
Christian Zürcher ist Käser und Direktor der Fromco. Er war bereits als Superjudge in der Expertenjury an den World…
12.11.2025 12:00
Land & Leute
Menschen
Auch Käse-Weltmeister habens nicht leicht
Im abgelegenen Vorderfultigen BE machte Urs Leuenberger Gruyère AOP, der 2022 an den World Cheese Awards den…
12.11.2025 08:00
Land & Leute
Leben & Geniessen
Bei diesem Spiel geht es um die Wurst
«Ramsen» ist ein einfacher Jass, der in der Altjahrswoche in Teilen der Nordwestschweiz gespielt wird. Wie in…
11.11.2025 16:20
Vermischtes
Vermischtes
Allerlei
Polarlichter im Doppelpack
Gleich zwei Mal haben sich am Mittwoch in der Schweiz Polarlichter gezeigt. Zum ersten Mal zeigte sich das…
13.11.2025 11:20
Vermischtes
Allerlei
Zuerst 50'000 Kilometer fahren für bessere CO2-Bilanz
Die Umweltbilanz von Elektroautos ist über die gesamte Lebensdauer besser als bei Verbrennern. Die Herstellung eines…
13.11.2025 06:50
Vermischtes
Allerlei
Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien
Die Spermienqualität von jungen Männern in der Schweiz unterscheidet sich je nach Wohnort. So scheinen Männer aus…
13.11.2025 06:20
Vermischtes
Allerlei
Am Mittwochabend gibts Polarlichter zu sehen
Intensive Sonnenstürme haben in der Nacht für Polarlichter bis weit in den Süden gesorgt. Auch in der Schweiz waren…
12.11.2025 12:40





















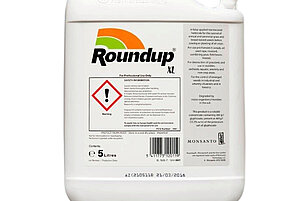

















Nicht abgebauter Zaun kann teuer werden
«Wir verarbeiten mehr – zum Wohl der Milchwirtschaft»
Dumpingpreise: Fenaco in Kritik
Studierende stimmten über pflanzliche Menüs ab
Wolf: Kommission will mehr Abschüsse ermöglichen
Käser rufen zur Reduktion der Milchmenge auf
SGPV: Glauser tritt nach 18 Jahren als Präsident ab
«Billig-Pfünderli sind ein Marktversagen»
Gericht stärkt Produzenten: Notfallzulassungen bleiben erlaubt
Fast vergessenes Gemüse feiert Comeback
Neue Rinder-Apps vereinfachen Tierverkehr
Schweiz: Es wird heisser und trockener
Landwirt für Anbautechniken mit Preis ausgezeichnet
Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu
Unerwünschtes Verhalten: Zwei Wolfsrudel dürfen geschossen werden
Wölfe im Tessin: Bauern fürchten um ihre Alpwirtschaft
Setzt Ihr auf Natursprung?
Feldtage 2026 an neuem Standort
Mehr Baumsterben durch Insekten
Micarna: Rückschlag für Schlachthof-Gegner