Zuerst war Pro Natura an der Reihe in der Aula des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg . Marcel Liner, der Agrarpolitikchef von Pro Natura, erklärte die Gründe zur Lancierung der Biodiversitätsinitiative. Der Verlust an Biodiversität sei messbar und besorgniserregend. Für ihn sind bei der «Biodiversitätskrise» alle Sektoren gefordert.
Nach ihm begründete Direktor Martin Rufer das Nein des Schweizer Bauernverbandes. Ihm zufolge würde die Initiative den ländlichen Raum massiv lähmen. Einig waren sich die beiden Vortragenden darin, dass Biodiversität wichtig ist und die Landwirtschaft bereits sehr viel zur Erhaltung der Biodiversität leistet.
Andreas Meier: «Schlicht unnötig»
Beim anschliessenden Podium hatte Rufer Mitte-Nationalrat und Winzer Andreas Meier neben sich. Meier merkte an, dass eine Verfassungsänderung einen riesigen Aufwand mit sich brächte und die Landwirtschaft heute aus Eigeninitiative schon viel für die Biodiversität tue. Zudem schrecken ihn die grossen Kosten der Initiative ab: «Von den 400 Millionen, die zusätzlich ausgegeben werden sollen, ginge ein grosser Teil für Kontrollen verloren. Diese 400 Millionen werden auf keinen Fall in die Landwirtschaft gelangen.»
Rufer dankt Liner
Liner anerkannte, rein flächenmässig habe die Landwirtschaft das gesetzte Biodiversitätsziel erfüllt. Das Biodiversitätsproblem gehe aber tiefer und sei auch im hohen Tierbesatz, dem damit verbundenen Kraftfutterzukauf sowie dem Ausbringen von Insektiziden begründet. Daran seien aber nicht die einzelnen Betriebe schuld, sondern das gesamte Landwirtschaftssystem.
Rufer reagierte wie folgt: «Herzlichen Dank, Marcel, für diese Offenheit und Transparenz, nun haben wir gehört, worum es wirklich geht: um den Abbau der Nutztierbestände. Das ist das Ziel, das wahrscheinlich auch mit dieser Initiative angestrebt würde».

Martin Rufer ist ETH-Agronom und seit 2008 beim Schweizer Bauernverband angestellt, seit 2020 als Direktor.
Daniel Salzmann
Pro Natura: Von 8% auf 30%
Er wollte von Liner wissen, wo die zusätzlich geforderten Flächen zu liegen kommen sollen, wenn nicht massgeblich auf der Landwirtschaftsfläche. Denn laut einer von Rufer zitierten Medienmitteilung von Pro Natura müssten 880’000 ha zusätzliche Biodiversitätsvorrangflächen definiert werden, da für Pro Natura nur 8 % der Schweizer Landesfläche den Kriterien genügen und die Organisation auf die Einhaltung des 30 %-Ziels pocht.
Liner nannte darauf als Beispiel lichtfreie Korridore im Siedlungsgebiet und die Schaffung eines zweiten Nationalparks, ohne konkreter zu werden. Irène Kälin wies an dieser Stelle darauf hin, dass im Initiativtext keine Zahl zu den Flächen stehe.
Kälin: «Umsetzung wäre in Hand des Parlaments»
Kälin sagte ferner: «Die Umsetzung der Initiative nach einem Ja des Volks läge in der Hand des Parlamentes, das bekanntlich bauernfreundlich ist.» Die Landwirtschaft sei heute ein Sektor, der zurecht schon viel machen muss und dies auch tue. «Darum verstehe ich nach wie vor nicht, weshalb ich euch hier als Gegner habe, eigentlich müssten wir alle im selben Boot sitzen», so Kälin.
Rufer entgegnete, dass der Initiativtext nicht isoliert betrachtet werden dürfe, sondern die ganze Kommunikation der Initianten und Organisationen miteinbezogen werden müsse. Meier gibt Kälin teilweise recht, dass die Zahlen vom Bund tatsächlich nicht genau bekannt sind bezüglich der Fläche, welche für die Biodiversität eingesetzt werden soll. Er findet aber dennoch, dass die Landwirtschaft fälschlicherweise im Fokus steht, da beispielsweise im Kanton Aargau die Biodiversität in der Landwirtschaftszone zunehmend sei, entgegen der Entwicklung im Siedlungsgebiet.

Agrarpolitik Liebegg, Gränichen, Marcel Liner, Irène Kälin, Ralf Bucher (Moderator), Martin Rufer, Andreas Meier (v.l.)
Daniel Salzmann
Einwand von Alois Huber
In der Fragerunde kritisierte SVP-Nationalrat Alois Huber, dass Liner und Kälin der Landwirtschaft nun Honig ums Maul strichen während sie sie sonst hart kritisieren und gar bei ihnen sparen möchten. Er bitte um Ehrlichkeit.
Liner sagte, er habe zwei Herzen in seiner Brust. Eines für die einzelnen Bäuerinnen und Bauern, die viel für die Biodiversität täten. Eines für den Sektor, der die Umweltziele nicht erfülle. Kälin bat um Genauigkeit: Die grüne Fraktion sei bei der Budgetdebatte bezüglich Landwirtschaft gespalten gewesen.
Erfolg abhängig von bäuerlicher Mobilisierung
Auf die Bitte, eine Prognose zur bevorstehenden Abstimmung zu machen, gab sich Rufer optimistisch und sagte, mit einer guten Kampagne sei ein deutliches Nein zu erreichen. Auch Kälin verwies auf die bäuerliche Nein-Kampagne und meinte, wenn im selben Ausmass mobilisiert wird, wie bei vergangenen Abstimmungen stehe den Initianten eine grosse Aufgabe bevor.
Für Meier stehe ebenfalls eine grosse Aufgabe bevor, wenn er den Nationalrat als Gradmesser nehme. Liner weitete den Blick aus und wies darauf hin, dass die Initiative nur ein erster Schritt sei und mit der Agrarpolitik 2030 deutlich mehr auf die Landwirtschaft sowie die gesamte Gesellschaft zukomme.
«Ihr habt noch Glück»
Das Schlusswort hielt Christof Hagenbuch, Präsident des Bauernverband Aargau. Er ermutigte die Umweltseite, vor der Lancierung solcher Initiativen jeweils mit der Landwirtschaft zu reden, das lohne sich. Er überreichte den Gästen einen Geschenkkorb von der Liebegg. Zu Liner und Kälin sagte er: «Ihr habt natürlich grosses Glück. Nach Annahme der Biodiversitätsinitiative wäre dieser um rund einen Drittel kleiner, weil wir weniger produzieren können.» Viele im Saal lachten.

Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands Aargau, hielt ein engagiertes Schlusswort.
Daniel Salzmann
Der Initiativtext
Eidgenössische Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 78a Landschaft und Biodiversität
1 In Ergänzung zu Artikel 78 sorgen Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür, dass:
a. die schutzwürdigen Landschaften, Ortsbilder, geschichtlichen Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler bewahrt werden;
b. die Natur, die Landschaft und das baukulturelle Erbe auch ausserhalb der Schutzobjekte geschont werden; c. die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Flächen, Mittel und Instrumente zur Verfügung stehen.
2 Der Bund bezeichnet nach Anhörung der Kantone die Schutzobjekte von gesamtschweizerischer Bedeutung. Die Kantone bezeichnen die Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung.
3 Für erhebliche Eingriffe in Schutzobjekte des Bundes müssen überwiegende Interessen von gesamtschweizerischer Bedeutung vorliegen, für erhebliche Eingriffe in kantonale Schutzobjekte überwiegende Interessen von kantonaler oder gesamtschweizerischer Bedeutung. Der Kerngehalt der Schutzwerte ist ungeschmälert zu erhalten. Für den Moor- und Moorlandschaftsschutz gilt Artikel 78 Absatz 5.
4 Der Bund unterstützt die Massnahmen der Kantone zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität.
Art. 197 Ziff. 122 12.
Übergangsbestimmung zu Art. 78a (Landschaft und Biodiversität) Bund und Kantone erlassen die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 78a innerhalb von fünf Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stände.
Der Initiativtext war am Podium auf der Liebegg wiederholt Gegenstand der Diskussion. Martin Rufer betonte, dass das Wort Flächen im Initiativtext enthalten sei. Liner wiederum strich heraus, dass die von Rufer zitierten 30% nicht drin stehe. Ein weiteres Nein- Argument für Rufer ist, dass mit der Initiative neben der Artenvielfalt auch die Ortsbilder bewahrt werden sollen. Und vom Finanzsektor, wo Liner noch grösseren Handlungsbedarf sehe als bei der Landwirtschaft, stehe im Initiativtext kein Wort.

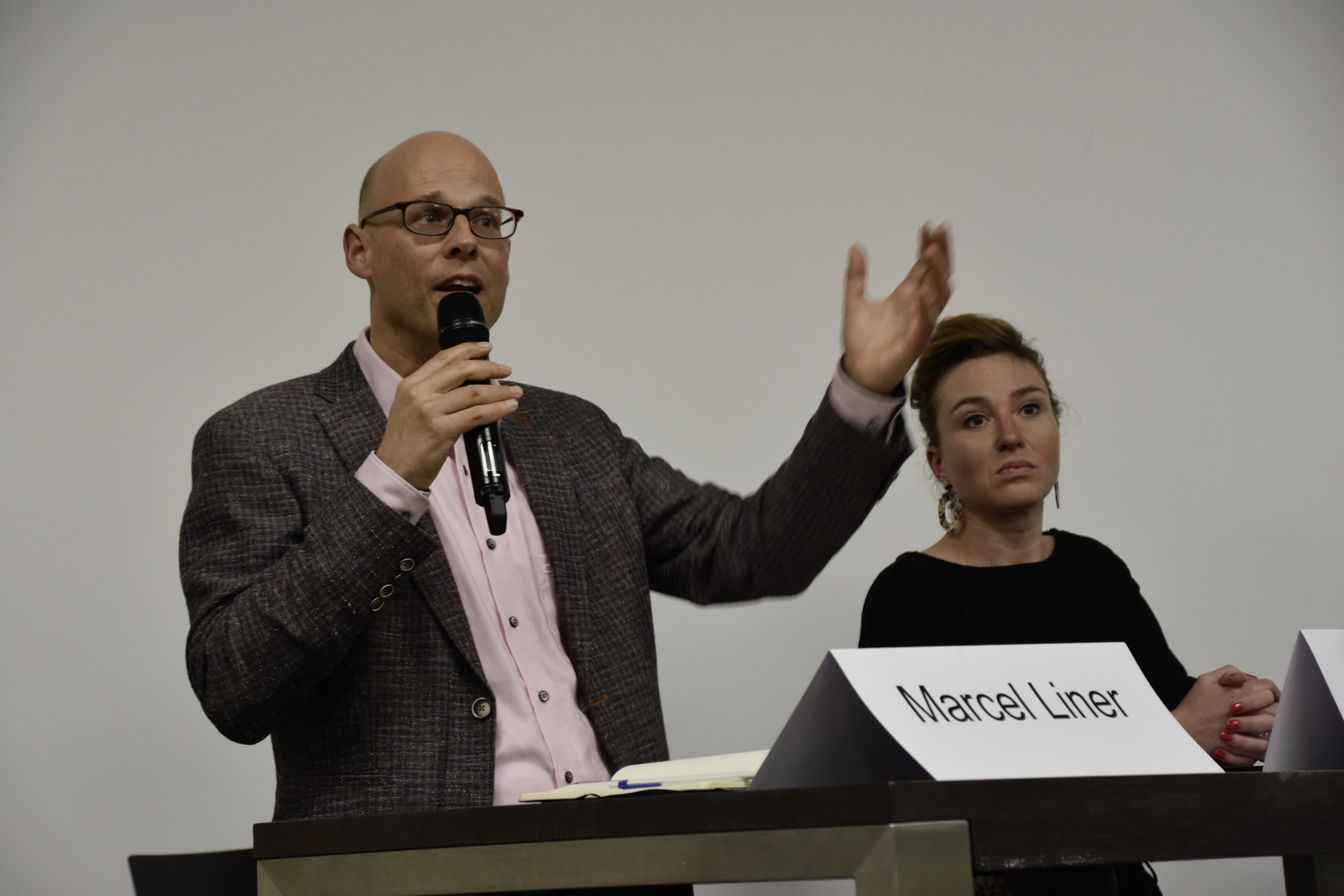


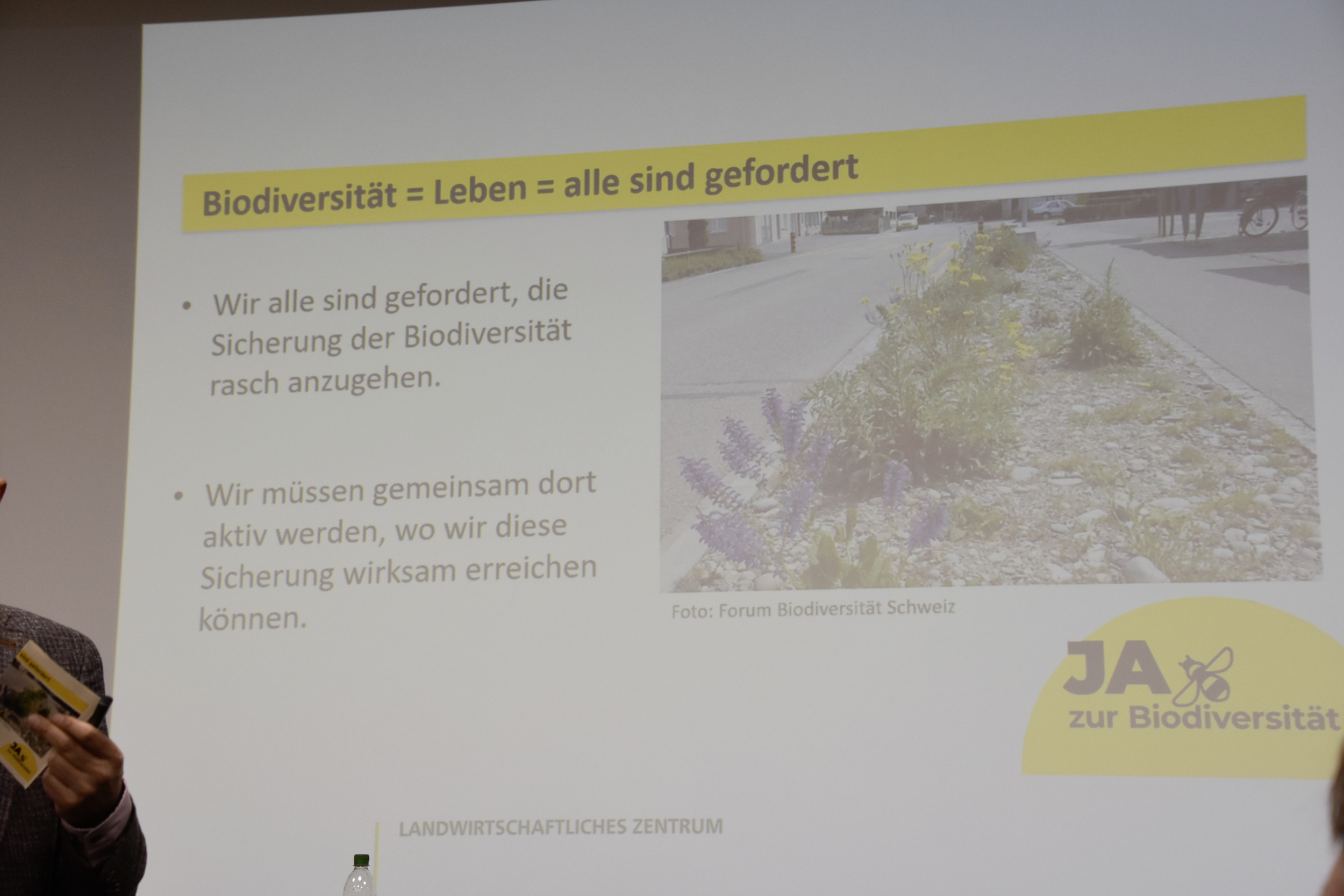


Es wäre mal an der Zeit Anforderungen an Unternehmen, Städte, Ballungszentren zu stellen damit auch dort auf deren Fläche erstmal 5% Ausgleichsflächen gemäss Bundesrichtlinien (wie von der Landwirtschaft verlangt) erbracht werden müssen. Ich sehe oft nur Steinwüsten und mit Glas verbaute Fassaden. Auch Banken und Versicherungen, die ja Pro Natura und ihren Bundesrat sponsoren ihren flächenmässigen Beitrag erfüllen müssen. Ebenso sind Alpen & Gletscher, nicht bewirtschaftbare Flächen im Alpenraum bereits heute als Ausgleichsflächen zu deklarieren. Es braucht nur den politischen Willen.