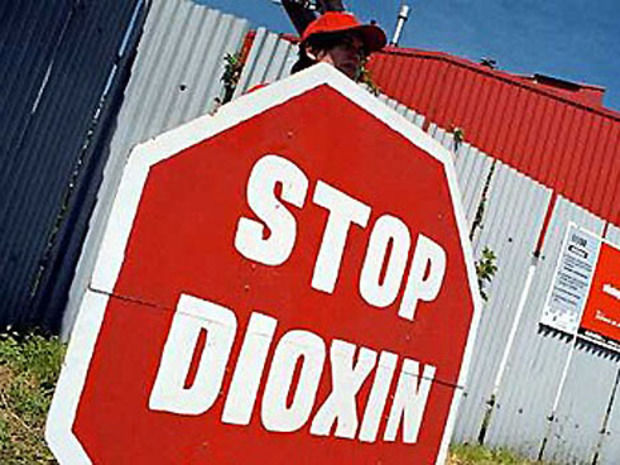Während die Kontrollen von Futtermitteln auf Dioxin und ähnliche Verbindungen strenger werden sollen, ist die Europäische Union künftig etwas nachsichtiger, was Spuren solcher Gifte in bestimmten Fleischprodukten angeht.
Wie aus einer Ende August im Amtsblatt veröffentlichten Empfehlung der EU-Kommission hervorgeht, wird der empfohlene Auslösewert für Dioxine und Furane in Fleisch von Rindern und Schafen gegenüber einem Wert aus dem Jahr 2006 um 0,25 pg auf 1,75 pg/g Fett angehoben. Für dioxinähnliche polychlorierte Biphenyle (PCB) in Wiederkäuerfleisch steigt der Auslösewert sogar um 0,75 pg auf dann ebenfalls 1,75 pg/g Fett. Andererseits wird die empfohlene Höchstmenge in Muskelfleisch von Fischen und Fischereierzeugnissen beim Dioxin auf 1,5 pg/g Frischgewicht und bei dioxinähnlichen PCB auf 2,5 pg/g Frischgewicht abgesenkt.
Bislang waren hier 3,0 pg/g Frischgewicht festgesetzt, für dioxinähnliche PCB gilt beim Aal sogar ein Schwellenwert von 6,0 pg/g. Diese Auslösewerte haben rechtlich keine bindende Wirkung. Bei Überschreitungen sollten die Mitgliedstaaten laut der Kommissionsempfehlung Tests zur Ermittlung der Kontaminationsquelle einleiten sowie „Maßnahmen zur Beschränkung oder Beseitigung der Kontaminationsquelle treffen“. Die neuen Auslösewerte sollen ab 1. Januar 2012 gelten. Nachdem in der Vergangenheit in Rindfleisch - offenbar wegen der weit verbreiteten Belastung von Böden - Probleme mit PCB registriert worden waren, hatte sich im Frühsommer der Naturschutzring gegen die Anhebung der Auslösewerte in Wiederkäuerfleisch gewandt. Das nordrhein-westfälische Agrarministerium hatte im Frühjahr über stellenweise erhöhte Dioxin- und PCB-Werte bei Leber und Fleisch von Tieren aus Weidehaltung berichtet.
Leitfaden vorgelegt
Unterdessen veröffentlichte das Bundesumweltministerium vergangene Woche einen aktualisierten Leitfaden für Nutztierhalter zur Vermeidung von Dioxin- und PCB-Einträgen. Das Ministerium empfiehlt, neue Auslaufbereiche für Geflügel, Rinder, Schafe oder Schweine auf ihre Eignung zu überprüfen. Beispielsweise könne in der Regel beim jeweiligen Landratsamt erfragt werden, ob in der Nähe der Hofstelle oder Flächen mögliche Kontaminationen durch Altlasten bekannt seien, beispielsweise aus stillgelegten Industriebetrieben oder Mülldeponien. Weitere Recherchen sollten sich laut der Broschüre unter anderem dann anschließen, wenn es Vorbelastungen wie die Versetzung der Böden mit Aschen und Schlacke gab. Zu solchen Vorbelastungen zählt das Ministerium auch Böden, auf die in der Vergangenheit größere Mengen Bioabfall, Kompost oder Klärschlamm aufgebracht wurden, Auffüllungen und Überdeckungen mit Aushub aus dem unmittelbarem Randbereich vielbefahrener Straßen oder von Bahndämmen sowie Böden, die regelmäßig überschwemmt wurden. Auch Brandstellen oder Plätze, an denen frührer Abfälle, Holz, Papier, Stroh oder Laub verbrannt wurden sowie ehemalige Stellplätze für den Maschinenfuhrpark werden zu Vorbelastungen gezählt. Dazu gehören auch Areale im Einwirkungsbereich lokaler Emittenten wie beispielsweise Sinteranlagen und Metallschmelzen.
Fütterungshinweise
Das Umweltministerium gibt in seiner Broschüre zudem Fütterungshinweise. Insbesondere hofeigene Futtermittel wie beispielsweise Rübenblattsilagen sollten demnach möglichst geringe erdige Verunreinigungen aufweisen. Deutlich verringert werden kann das Risiko einer Kontamination mit Dioxinen und PCB im Bereich der Geflügel-, Rinder-, Schaf- und Schweinehaltung laut der Broschüre auch, wenn eine vollwertige Fütterung mit allen den Bedarf deckenden Nähr- und Mineralstoffen sowie Spurenelementen in den Stallungen oder geeigneten Futtertrögen erfolgt. Dies mindere die zusätzliche Futteraufnahme im Auslauf, vor allem bei Hühnern. Weiter heißt es, in Deutschland gebe es nach derzeitigem Kenntnisstand keine nennenswerten Unterschiede im Dioxingehalt von vermarkteten Eiern aus unterschiedlichen Haltungsformen. Stroh mit einem hohen Anteil an Erde als Einstreu sollte laut den Ministeriumsempfehlungen nicht verwendet werden. (www.bmu.de/45787)