Vor 20 Jahren habe der Bund 7,4 Prozent seines Budgets für die Landwirtschaft ausgegeben, letztes Jahr noch 4,7 Prozent, hiess es vom Bauernverband vor den Medien in Bern. Und: Die jährlichen Ausgaben für die Landwirtschaft lägen seit 20 Jahren stabil bei rund 3,6 Milliarden Franken, während die Bundesausgaben um fast 40 Milliarden oder um über 80 Prozent gestiegen seien. «Die Landwirtschaft trägt also keine Schuld am Finanzloch.»
Sparpläne führen zu Protesten
Hintergrund des Bauernprotests am Mittwoch vor dem Bundeshaus waren unter anderem die Sparpläne des Bundes. Eine Expertengruppe des Bundes um den ehemaligen Chef der Finanzverwaltung, Serge Gaillard, hat potenzielle Einsparungen über alle Bereiche im Umfang von bis zu 5 Milliarden Franken ab dem Jahr 2030 ausgemacht.
Der Bundesrat will erst noch über Massnahmen entscheiden und eine Vorlage in die ordentliche Vernehmlassung geben. Im Anschluss soll das Parlament entscheiden.
«Ein erheblicher Betrag»
Die Bauern kritisierten, schon im Budget fürs nächste Jahr würden 48 Millionen Franken oder 1,4 Prozent eingespart, vor allem bei den Direktzahlungen. Beim landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen von 2026 bis 2029 sollen 230 Millionen Franken oder 1,6 Prozent wegfallen. Und der Gaillard-Bericht schlage als Beitrag der Landwirtschaft zur generellen Sanierung des Bundeshaushaltes nochmals eine Kürzung von gegen 210 Millionen Franken vor.
«Doch für viele Bauernfamilien, die jeden Franken umdrehen müssen und heute schon schlaflose Nächte haben, ist dies ein erheblicher Betrag, der letztlich fehlen wird», sagte Ritter.

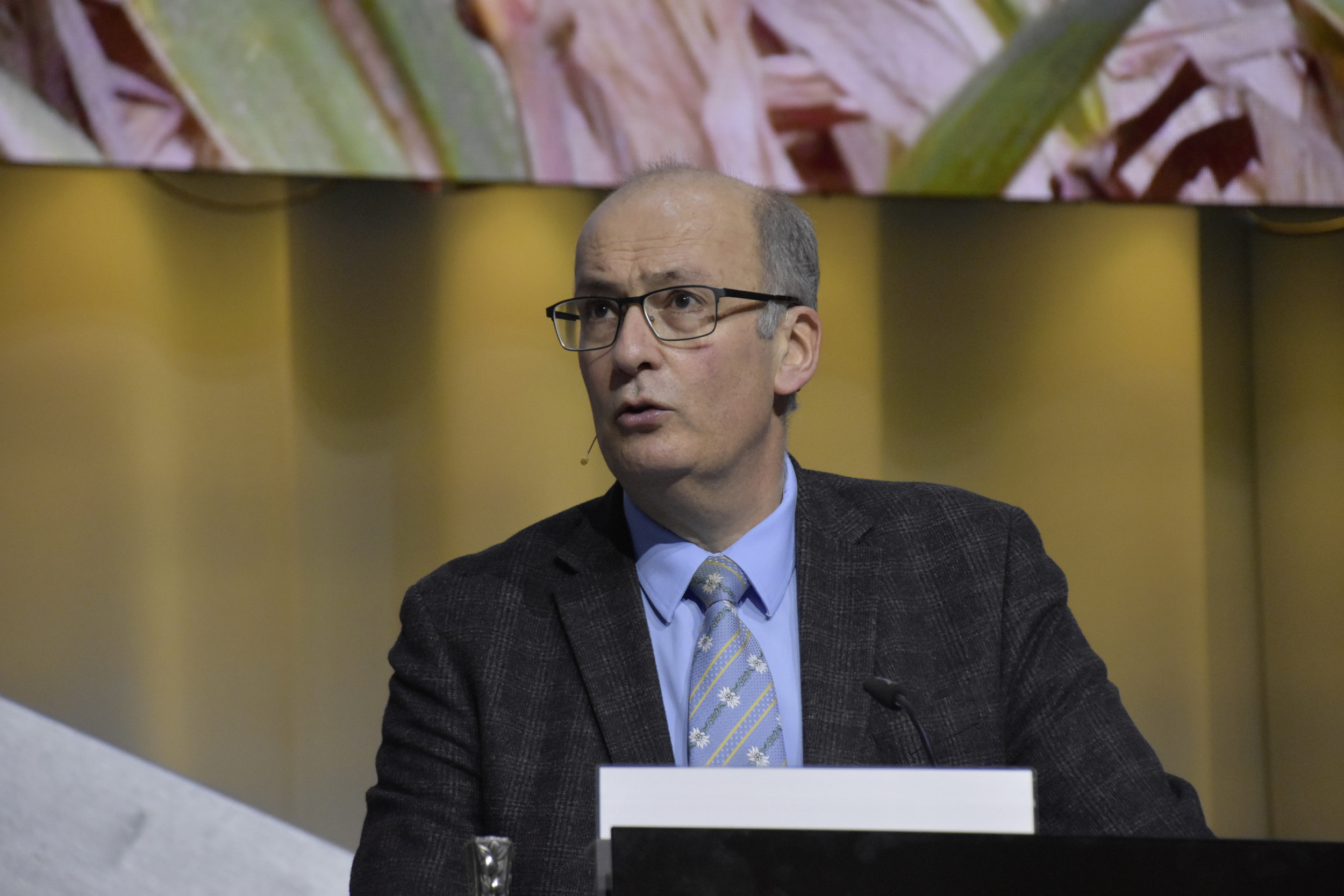


Und ja, ich bin der Erste welcher mithilft einen Plan auszuarbeiten, welcher die CH-Landwirtschaft in verkraftbaren Schritten von der Abhängigkeit der DZ wegführt. Das braucht aber sinnvolle und massvolle Massnahmen und würde im Endeffekt zu höheren Kosumentenpreisen führen. Damit dies politisch überhaupt umsetzbar wäre, müsste ein Teil der in der Landw. eingesparten Mittel in soziale Ausgleichsmassnahmen für tiefe Einkommensschichten fliessen.
Ritter: «Sparmassnahmen auf dem Buckel der Bauernfamilien sind nicht gerechtfertigt». Ja die Bauern sind die Privilegierten, bluten sollen die Normalos, soviel zu der Solidarität der Schweizer Bauern die seit Jahrzehnten von den SteuerzahlerInnen ausgehalten werden, ausgehalten werden müssen. Ritter ist arrogant und die Bauern sollen doch mit ihren Traktoren nach Bern fahren aber dann auch Mineralölsteuern bezahlen! Irgendwann ist genug mit dem jammern der Bauern, wenn sie Landwirtschaft nicht können sollen sie aufhören!
Und ja Herr Brunner, warum die "Normalos" bluten sollen, wissen Sie ja wohl besser als alle anderen: Damit wir an der militärischen Aufrüstungsspirale in Europa mitdrehen können und damit wir den Opfern dieser Aufrüstungsspirale Gratis-Schutz mit Rundumversorgung bieten können. Vielleicht sollten Sie dies etwas genauer hinterfragen, anstatt auf den täglich arbeitenden Landwirtinnen und Landwirten mit Pauschalverunglimpfungen herumzuhacken.
Und ja, wenn Sie schon die Tabellen vor Augen haben, dann finden Sie andere Berufsgruppen, die wohl deutlich mehr Verantwortung für die Teuerung tragen als die CH-Landwirtschaft.
@Martin
Die Schweizer Landwirtschaft ist stark durch Direktzahlungen und Zölle geschützt. Leider führt dies dazu, dass ein 40-Hektar-Betrieb weniger genau kalkulieren muss, da er durch umfangreiche staatliche Unterstützung gut abgesichert ist. Dies verzerrt das wirtschaftliche Bild, denn ob sich nun ein 10-Hektar-Betrieb den 211er Fendt nicht leisten kann oder ein 40-Hektar-Betrieb ihn sich eigentlich nicht leisten sollte, ist in beiden Fällen untragbar. Beide stehen vor der Realität, dass teure Maschinen auf kleinen und mittleren Betrieben kaum rentabel sind, wenn man ehrlich kalkuliert.
Die Abhängigkeit von staatlichen Geldern macht deutlich, dass die Schweizer Landwirtschaft nicht unternehmerisch unabhängig agieren kann und kaum konkurrenzfähig ist gegenüber dem Ausland – es sei denn, wir denken plötzlich an Betriebe mit 400 Hektar oder mehr. Stattdessen haben wir die Möglichkeit, unsere Landwirtschaft nach eigenen Werten zu gestalten. Wir sollten den staatlichen Schutz nicht als Einschränkung, sondern als Chance sehen, eine Landwirtschaft zu formen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Schweiz ausgerichtet ist.
Es bleibt jedoch klar, dass viele Betriebe ohne staatliche Unterstützung in ihrer jetzigen Form nicht überleben könnten. Egal ob 10 Hektaren Nutzfläche oder 40ha. Deshalb ist es entscheidend, die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaft offen zu diskutieren. Wollen wir eine Landwirtschaft, die weiterhin auf staatliche Hilfen setzt und kleine sozialverträgliche Strukturen sowie Familienbetriebe fördert, oder bewegen wir uns in Richtung einer Landwirtschaft mit grösseren, international wettbewerbsfähigen und unternehmerisch tragfähigen Strukturen? Diese Grundsatzfrage wird darüber entscheiden, wie sich die Landwirtschaft in der Schweiz langfristig entwickelt.
Somit ist doch sonnenklar, dass die staatliche Unterstützung im Gleichschritt mit dem Strukturwandel reduziert werden sollte. Sonst haben wir in 20 Jahren eine vollständig verstaatlichte CH-Landwirtschaft. Ich will das nicht, andere sehnen sich scheinbar danach. Landwirtschaftspolitik ist immer auch Bodenpolitik und Eigentumspolitik. Wer für das Recht auf Privateigentum auch am Boden einsteht, sollte dies zwischendurch bedenken.
Wer das Eigentum am Boden weiter verstaatlichen will, wird Mühe haben, die Landwirtschaft vom Gängelband der Politik zu befreien.
Und wie gesagt, es geht nicht um staatliche Unterstützung ja oder nein, es geht darum um wieviel staatliche Unterstützung und um einen schrittweisen Abbau. Dies hoffentlich nicht nur in der CH sondern weltweit. Und wenn man sich auf diesen Weg begeben will, braucht es soziale Begleitmassnahmen für einkommensschwache Konsumenten, die profitieren nämlich sehr stark von der staatlichen Untersützung der Lebensmittelproduktion.
Kleine Betriebe sichern nicht nur die regionale Versorgung, sondern spielen auch eine wichtige Rolle im ländlichen Raum, indem sie Arbeitsplätze schaffen und zur Erhaltung der dörflichen Gemeinschaften beitragen. Sie sind ein integraler Bestandteil der Schweizer Landwirtschaftslandschaft und verdienen es, gezielt unterstützt zu werden, damit sie nicht nur überleben, sondern auch ihren Familien ein auskömmliches Leben ermöglichen können – ohne auf Nebenerwerb angewiesen zu sein.
Grossbetriebe können durch Skaleneffekte und technologische Fortschritte zunehmend auf externe Unterstützung verzichten. Diese Entwicklung zeigt, dass die vorhandenen Mittel differenziert und mit Bedacht verteilt werden müssen. Eine pauschale Verteilung, die alle Betriebe gleichermassen unterstützt, verfehlt die spezifischen Bedürfnisse der kleineren Betriebe und gefährdet deren Existenz, während Grossbetriebe solche Gelder vergleichsweise leichter kompensieren können.
Zusätzlich tragen kleinere Betriebe oft stärker zur Klimaresilienz bei. Sie sind häufig flexibler und anpassungsfähiger, was es ihnen ermöglicht, auf lokale klimatische Veränderungen schneller zu reagieren. Diese Betriebe pflegen oft traditionelle Anbaumethoden und Praktiken, die sich an die regionalen Gegebenheiten anpassen und somit besser auf klimatische Herausforderungen reagieren können. In einer Zeit, in das Klima immer mehr in den Fokus kommt, ist es wichtig, solche klimaresilienten Strukturen gezielt zu fördern.
Eine starke Agrarpolitik muss sicherstellen, dass auch kleine landwirtschaftliche Betriebe (bis 10-15 ha) eine klare wirtschaftliche Perspektive haben. Sie tragen erheblich zur Stabilität und Vielfalt des Schweizer Agrarsektors bei, sichern die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Produkten und stärken die Klimaresilienz der Landwirtschaft. Direktzahlungen sollten deshalb gezielt an die Bedürfnisse kleinerer Betriebe angepasst werden, damit diese langfristig bestehen können und nicht in eine immer grössere Abhängigkeit von Nebentätigkeiten gedrängt werden.
Die Verteilung der Gelder muss so gestaltet werden, dass die kleineren Betriebe überdurchschnittlich stark gestützt und gefördert werden, um ihnen eine solide wirtschaftliche Grundlage zu bieten und gleichzeitig die Klimaresilienz der gesamten Landwirtschaft zu stärken. Nur so kann eine vielfältige, starke und zukunftssichere Landwirtschaft in der Schweiz erhalten bleiben.
Das Zünglein an der Waage sind die Grossisten - diese sind jedoch leider (wie schon immer und immer noch) Marge, Profit und Gewinnorientiert, weit entfernt der Schweizer Landwirtschaft - da spielt die Grösse wohl eine untergeordnete Rolle...
Kleine Betriebe haben durchwegs eine Zukunft mit Nischen, Spezialkulturen, Agrotourismus usw., diese Betriebe brauchen aber ebenso nicht zusätzliche staatliche Unterstützung wie dies Frau Greenvale fordert. Allenfalls brauchen diese Betriebsformen mehr Freiheiten betreffend Raumplanung usw.
Es ist 35 Jahre nach Einführung der DZ an der Zeit und Aufgabe der Landwirtschaft, einen Plan auszuarbeiten, wie wir die Abhängigkeit von diesen staatlichen Zahlungen (und der damit verbundenen Bevormundung) reduzieren können und wollen. Dies immer mit dem Fokus darauf, dass unsere einheimische Produktion nicht durch zusätzlichen Import verdrängt wird. Und auch mit dem klaren Ziel, das Einkommen der in der Landwirtschaft tätigen Personen zu verbessern. Eine Idee von mir wäre; Schrittweise Reduktion der DZ, verbunden mit verbessertem Grenzschutz und rigoroser Beschränkung des Einkaufstourismus. Dies müsste zu steigenden Nahrungsmittelpreisen im Inland führen. Die Hälfte der bei den DZ eingesparten Bundesmittel würden eingesetzt um die KRK-Prämien der tiefen Einkommmensschichten stärker zu verbilligen. So könnten sich auch diese Personen die höheren Lebensmittelpreise in der CH leisten. Solche Kompromisse könnten auch politisch Mehrheiten finden und die produzierende Landwirtschaft von der Abhängigkeit des Staates befreien und noch näher an den Markt heranführen. Zudem würden steigende Preise die Achtung vor den Lebensmitteln steigern, FoodWaste verringern und das Einkommen in der Landwirtschaft verbessern.
Jetzt will man bei den Bauern (seit 20 Jahren kein Teurungsausgleich) sparen.