Der Film mit dem allgemeinen Titel «Unser täglich Fleisch – von Gülle, Jobs und Umweltschäden» fokussiert auf die Schweinehaltung rund um den Baldeggersee im Kanton Luzern, der seit den 1980er Jahren wegen Überdüngung belüftet werden muss.
«Tiermast am falschen Ort»
Die Hauptaussage ist, dass gemäss dem Gewässerchemiker Bernhard Wehrli sich der See in gut zehn Jahren erholen würde, wenn die Tierhaltung rund um den See konsequent beschränkt würde. Wenn es so weitergehe wie jetzt, sei eine Gesundung des Sees noch auf viele Jahrzehnte hinaus quasi unabsehbar.
Doch der Kanton Luzern toleriere wegen der starken «Landwirtschaftslobby» und dem wichtigen Wirtschaftszweig, den die Tierhaltung insgesamt darstelle, diese Verletzung des Gewässerschutzgesetzes. Wehrli sagt im Film: «Die Tiermast ist am falschen Ort. Wenn man in der Schweiz intensive Tiermast betreiben will, dann kann dies nicht im Einzugsgebiet von sensitiven Seen sein. Entschuldigung, das ist einfach so, das ist wissenschaftlicher Fakt.»
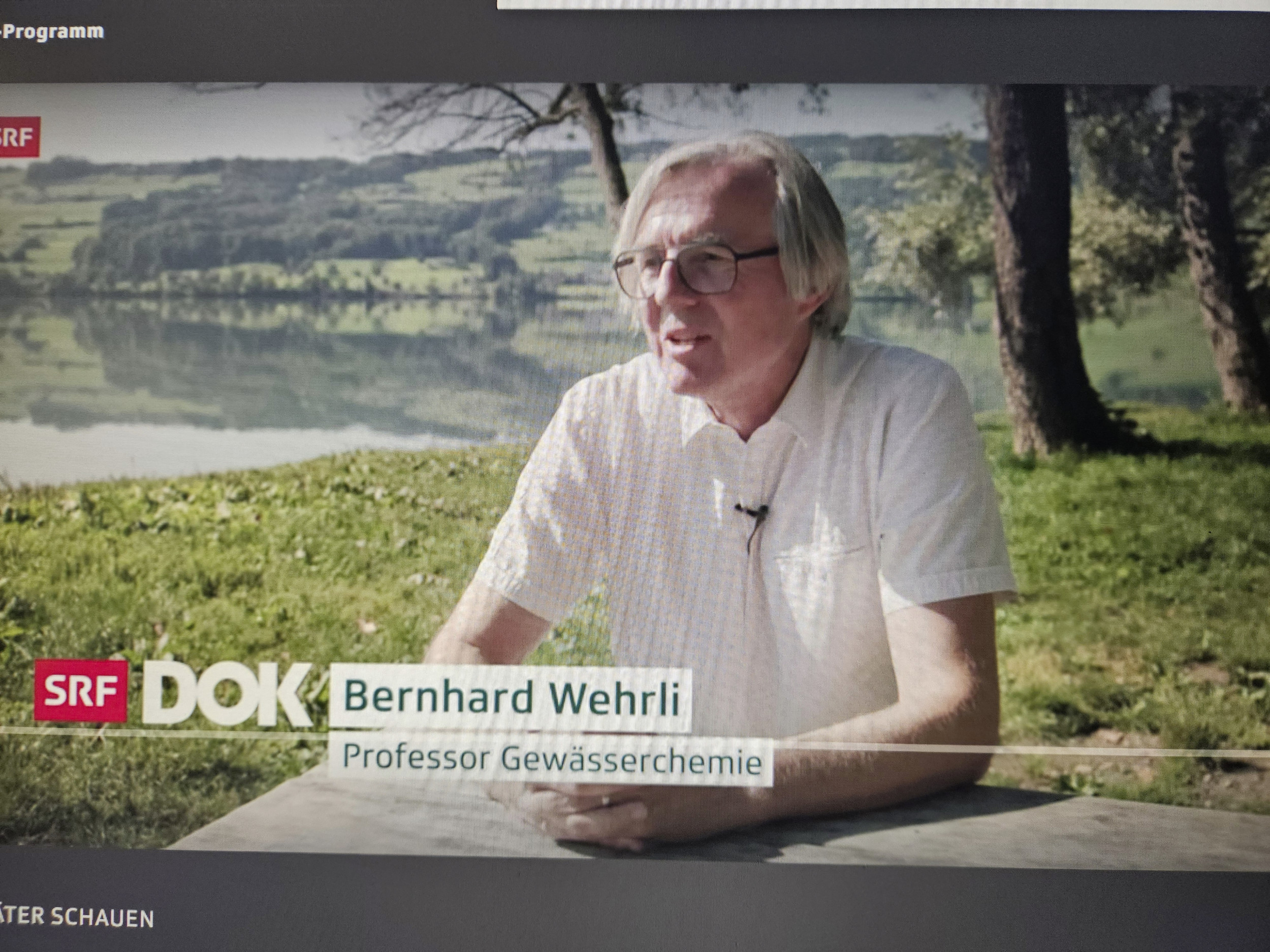
Unser täglich Fleisch. Bernhard Wehrli, Gewässerchemiker
Screenshot SRF
SRF-Film zeigt kritische Haltung zu «Masseproduktion»
Die hierzulande übliche Schweinehaltung wird mit Begriffen wie «Massenproduktion» und «Kind» für ein Ferkel und «Gebärmaschine» und Fragen wie, ob die Schweine denn keine Namen haben und ob es überhaupt Schweizer Schweine sind angesichts von rund 60% Importfutter und ob der Mensch überhaupt das Recht habe, ein Tier zu töten, scheinbar grundsätzlich hinterfragt. Auch wird die Trennung der Ferkel von der Muttersau gezeigt und die Tötung des Schweins Nr. 6003.
Indem filmisch auf ein einzelnes Tier fokussiert wird, wird Nähe zu diesem aufgebaut. Auffällig ist auch, dass konsequent von Steuerfranken und Steuermillionen die Rede ist, was beim SRF nicht bei jeder Ausgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden der Fall ist. Der Film endet mit dem Mahnfinger: In der Schweiz sollte jede Person 70 Prozent weniger Fleisch essen, um die Umwelt zu schonen.
Kilian Baumann sorgt sich um Arthur Röösli
Die Hauptperson im Film ist Arthur «Turi» Röösli aus Schweinezüchter in Hohenrain LU. Das Dorf liegt neben dem Baldeggersee. Biobauer und Grünen-Nationalrat Kilian Baumann, der den Dokfilm begrüsst, schreibt auf X über Röösli: «Schweinezüchter Turi Röösli hat den Mut, öffentlich über die Missstände der Schweizer Agrarpolitik zu sprechen. Das hat ihm viele und auch mächtige Gegner eingebracht. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Turi.»
Schweinezüchter Turi Röösli hat den Mut, öffentlich über die Missstände der Schweizer Agrarpolitik zu sprechen. Das hat ihm viele und auch mächtige Gegner eingebracht. Ich mache mir nun ernsthaft Sorgen um Turi. https://t.co/BnemmvIKuw
— Kilian Baumann (@Kilian_Baumann) December 16, 2023
Allerdings kritisiert Röösli nicht die ganze Agrarpolitik. Im Gegenteil, er erscheint durchaus als typischer Schweinezüchter, wie es auch im Film heisst. Auf den Vorwurf, er zerstöre aus wirtschaftlichen Gründen seine Grundlage, sagt Röösli: «Ich weiss nicht, inwieweit der Baldeggersee unsere Grundlage sein soll, das muss ich auch ehrlich sagen.» Auf den Einwurf, es gehe um Biodiversität, sagt er: «Auf allen unseren Feldern haben wir eine gewisse Biodiversität, die ich erfülle.»
Röösli verteidigt Schweinehaltung und Futtermittelimport
Er frage sich auch, ob mit der Seebelüftung der richtige Ansatz gewählt worden sei, wenn man sehe, dass nach 40 Jahren keine Fortschritte feststellbar seien. Er sagt auch, wenn wirklich auch derzeit noch die Gülle so schlimm wäre, hätte man das Güllen schon verboten. Auf den Einwurf, die Landwirtschaftslobby sei eben stark, verweist er darauf, dass es nicht nur um die Landwirtschaft gehe, sondern auch um die vor- und nachgelagerten Branchen.
Der Film illustriert dies mit der Zahl von einer Milliarde Franken Umsatz im Jahr, die im Schweinevalley rund um die drei Mittelandseen Baldeggersee, Sempacher See und Hallwiler See entstanden sei. Dazu zählten: Schweinebetriebe, Metzgereien, Futtermühlen, Stallbauer, Schweine- und Güllentransporteure.
Vater Röösli hat kein schlechtes Gewissen
Röösli sagt auch: «Wenn bei uns das Schweinefleisch nachgefragt wird, dann produzieren wir in der Schweiz Schweinefleisch.» Er verteidigt auch den Futtermittelimport, wenn ein Schwein in der Schweiz gelebt habe, gebe das Schweizer Fleisch, und betont, seine Lieferantin, die UFA AG, kaufe wenn immer möglich Soja aus Europa ein. Röösli war auch schon in der UFA-Revue , dem Magazin des Fenaco-Konzerns, abgebildet. Im Übrigen zeigt sich Röösli, der 140 Mutterschweine hält und auch Schweine mästet, gegenüber SRF auch offen, was seine Buchhaltung betrifft.
In guten Jahren mache er bei einem Umsatz von 700’000 Franken einen Gewinn von 150’000 Franken vor Steuern. In schlechten Jahren halbiere sich der Gewinn, weil der Schweinepreis schwanke. Auch der Vater von Turi Röösli, Arthur Röösli senior, kommt im Film vor. Er sagt, man habe schon gedacht, dass ein Teil der Probleme im See vom Güllen her rühren könnte - «aber richtig beweisen haben sie das ja nicht können.» Er habe auch kein schlechtes Gewissen, sicher nicht, so der Vater, «das kommt ja nicht von mir aus, sondern von der Politik, von den Vorschriften.»
Röösli hat einen neuen Luftwäscher installiert
Was Röösli auf die Palme bringt, ist das Vorgehen im Ressourcenprojekt Geruch in Hohenrain LU, das massgeblich vom Kanton Luzern finanziert wird und vom Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) geleitet wird. Der Hauptvorwurf im Film lautet, dass der Geruch aus den Schweineställen dort erwiesenermassen «übermässig» sei, weswegen von Gesetzes wegen Massnahmen ergriffen werden müssten. Doch das Ressourcenprojekt setzt auf Freiwilligkeit.
Röösli hat in dessen Rahmen für 250’000 Franken einen Luftwäscher installiert. Doch er sei der einzige Landwirt, der etwas gemacht habe. Seine Kollegen in unmittelbarer Nachbarschaft würden «weiterwursteln». Das beklagte Röösli bereits in einem Dokfilm mit dem Titel «Stunk wegen Schweinegestank», ebenfalls von SRF-Filmemacherin Karin Bauer, der im März 2023 ausgestrahlt worden ist und auf srf.ch und auf Youtube abrufbar ist.
Schweineställe sorgen für Stunk
Im luzernischen Hohenrain gibt es viele Schweine. Das führt zu Emissionen. Und sorgt für Unruhe im Dorf. Ein Projekt zur Verminderung des Geruchs, das vom kantonalen Bauernverband geleitet wird, verläuft harzig, wie eine Reportage des TV-Senders SRF im März 2023 zeigt. -> Mehr dazu hier
Röösli will gegen den Luzerner Bauernverband klagen
Im neuen Film berichtet Röösli nun, dass er für den Luftwäscher nur 30’000 Franken statt 50’000 Franken als Beitrag ausbezahlt bekommen habe. Der LBV wollte ihm die restlichen 20000 Franken erst nach Projektende in fünf Jahren bezahlen. Es gab darum eine Verhandlung vor dem Friedensrichter. Röösli berichtet im Film: «Raphael Felder vom Bauernverband hat wirklich herausgegeben, das sei der Grund, das sei ein Mitgrund dafür, dass sie die 20’000 Franken zurückbehalten, dass ich mit meinen Aussagen in diesem Reporterfilm im Schweizer Fernsehen das Projekt torpediert habe.» Er habe damit die Mitwirkungspflicht verwirkt, habe man ihm gesagt, dabei sei ja gerade er derjenige gewesen, der etwas gemacht habe.
Laut der Off-Stimme im Film habe der Bauernverband später Teilzahlungen bis Ende 2026 vorgeschlagen, doch Röösli lehne das ab und werde vor Gericht klagen. «Das zieht der Röösli jetzt einmal durch, dessen könnt ihr sicher sein.» Er werde nun überall schonungslauf aufzeigen, wie man mit ihm umspringe und dass so klar sei, dass kein Bauer freiwillig mitmache. Es sei ihm egal, wenn man ihm deswegen drohe. Vorher im Film erfuhr man, dass er bei einer Informationsveranstaltung im Kreis der Bauern massivst angegriffen worden sei. Beim Herausgehen sagte Alt-Mitte-Nationalrat und Ing. Agr. Josef Leu vor laufender Kamera zu ihm, er sei ein «Saftladen-Vertreter».
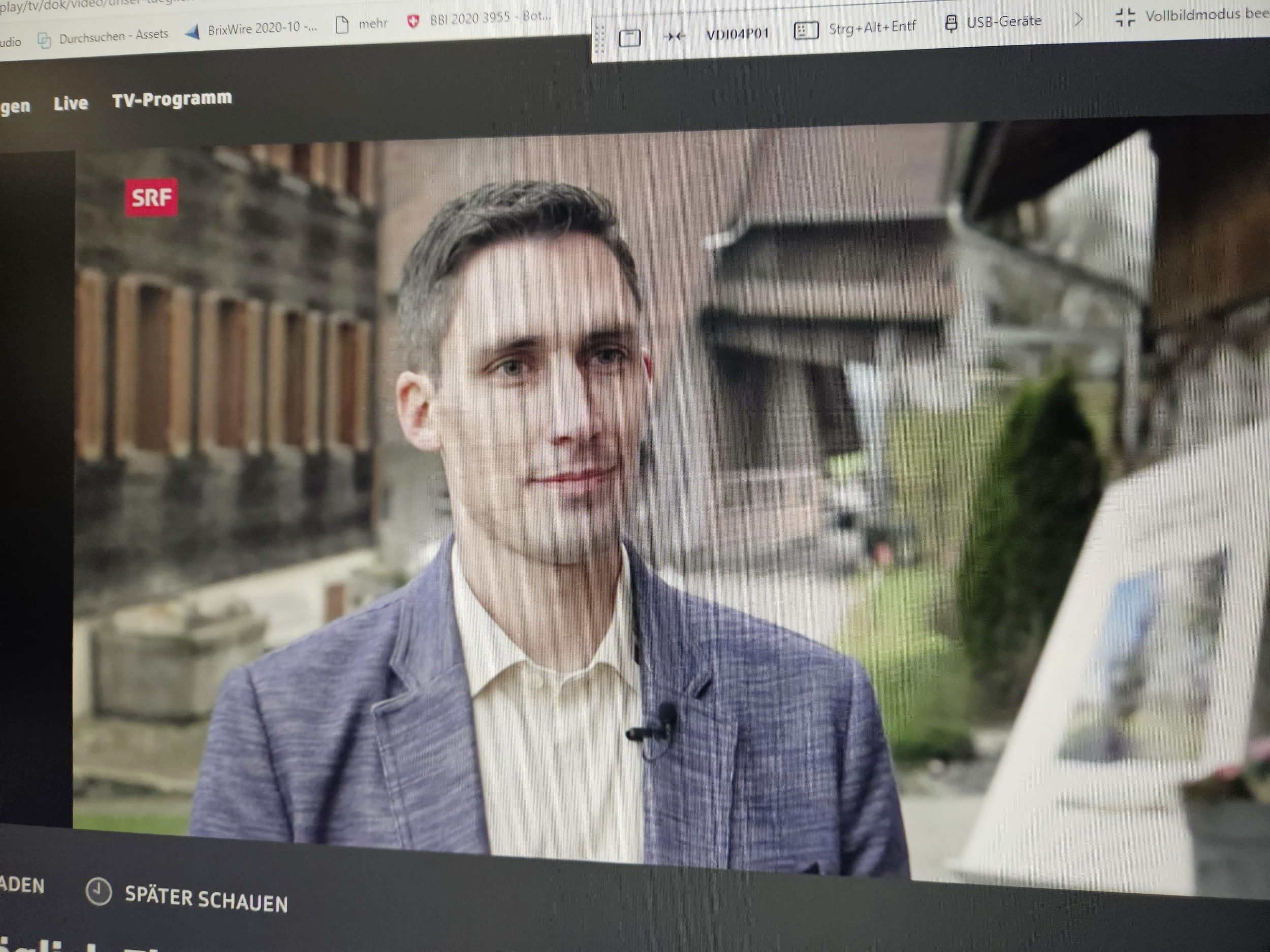
Raphael Felder, Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes.
Screenshot SRF
Luzerner Bauernverband: «Kein Auszahlungstermin festgelegt»
Gegenüber 20min.ch argumentierte der LUBV damit, es sei kein Termin für die Zahlungen festgelegt worden. Am Montagabend sagte LUBV-Geschäftsführer Raphael Felder gegenüber der SRF-Sendung Schweiz aktuell, es sei «ein Learning», dass es wichtig sei, die Auszahlung der Beiträge terminlich genau zu regeln.
Der Zuschauer fragt sich: Hätte Röösli ein weiteres Mal in einem SRF-Film mitgemacht, wenn ihm unmittelbar nach seinem Filmauftritt im März 2023 die 20’000 Franken ausbezahlt worden wären, mit der Idee, den Kritiker Röösli auf keinen Fall weiter gegen den LBV und gegen das Geruchsprojekt aufzubringen?
Gaht's na @srfnews? Die gestrige DOK-Sendung zu den Schweinen und der Beitrag in 10 vor 10 zur Gülle sind auf dem journalistischen Niveau von Fox News. Von ausgewogener Berichterstattung keine Spur. 🤬 pic.twitter.com/WeVwFTm3Zp
— Schweizer Bauernverband (@sbv) December 15, 2023
Schweizer Bauernverband stört sich am Dok-Film
Der Schweizer Bauernverband schrieb auf X: «Gaht’s na, SRF News? Die gestrige DOK-Sendung zu den Schweinen und der Beitrag in 10 vor 10 zur Gülle sind auf dem journalistischen Niveau von Fox News. Von ausgewogener Berichterstattung keine Spur.»
Auf Facebook wiederholte der SBV diesen Vorwurf und kündigte an, man habe bei 10 vor 10 interveniert und verlange, dass sich die Kritisierten auch noch äussern dürften. Bezüglich der Dok-Sendung plane man eine offizielle Beschwerde, so der SBV.




Die Politik sowie die Ämter haben da Reihenweise versagt wenn sie seit Jahrzehnten nichts hinbekommen!
Es würde allen dienen sich dieser Misere anzunehmen rund um diese Region! Vielleicht würde helfen statt verurteilen durch die Medien mehr bringen! Lösungen sind gefragt!
Hat man eigentlich mal untersucht wieviel Phosphor und andere Nährstoffe durch Kläranlagen in diese Seen gelangen? Ich denke mit der massiven Überbevölkerung in der Schweiz ist dies das grössere Problem als die Landwirtschaft!
Hier ist die Wissenschaft gefordert Grundlagenforschung zu betreiben denn dies wird irgendwann überall in der Schweiz zum Problem werden. Auch die vielen Medikamente und Hormone im Wasser müssen mal angegangen werden da müssen alle vor ihrer eigenen Haustüre wischen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen!
Medikamente und Hormone sind eine andere Geschichte. Da müssen sich die Kläranlagen laufend auf neue Herausforderungen anpassen (wobei auch dabei die Landwirtschaft nicht ganz unschuldig ist..).
Es fehlen Beiträge die zeigen, dass es sehr wohl Betriebe gibt die die Prozesse im Stall und mit Hofdüngern so steuern, dass es kaum mehr stinkt und Hofdünger wertvoll werden. In diesem Bereich wäre noch grosser Forschungs- und Bildungsbedarf.
Ich habe vor einem Jahr aus einem öffentlichen Gewässer 2 Wasserproben gezogen und auswerten lassen. Resultat : Fäkalbakterien 5000 KBE/ ml bei einem Höchstwert von max. 100, Nachweisbar Enterokokken und Escherichia Coli Bakterien. Nitrat 7.0 mg/l bei max. 40 .
Ich denke das kommt definitiv nicht aus der Landwirtschaft.
Phosphorkonzentration in den Luzerner Seen zu konsultieren. Wir sind noch nicht am Ziel aber auf dem richtigen Weg.Eben erst angegangene Umsetzungen z.B Schleppschlauchverteiler beim Ammoniakverlust werden ihre Wirkung erst noch zeigen.Verminderung von Geruchsimisionen sind ein Spagat zwischen hohem Tierwohl und Luftqualität und sehr teuer in der Umsetzung.Da stellt sich die Frage ob Staatsbeiträge nicht besser bei der produzierenden Landwirtschaft eingesetzt würden wo hoher Investitionsbedarf vorhanden ist
An einem Tierabbau führt kein WEg vorbei.
Das ist die Kritik am LBV, der Vorstand sollte hier handeln.
Bezüglich Sendung, da gibt es wohl unterschiedliche Meinung.
Teile und herrsche.