Bio Suisse hat beim Schweizer Bauernverband mit Erfolg den Antrag eingebracht, dass die 3,5% Biodiversitätsförderflächen auf Ackerland erst 2025 eingeführt werden. Der Dachverband beklagt, dass deswegen dringend gesuchte Bio-Ackerflächen verloren gingen. Und sie fürchtet «problematische Unkrautdepots in Brachen und Blühstreifen». Bio Suisse hat allerdings die 3,5% bislang befürwortet, auch die Kriterien zur Erfüllung.
Bio Suisse, der Dachverband, der um die 7500 Biobetriebe in der Schweiz vertritt, störte sich bislang nicht am Kriterium, das Bundesrat und Parlament von allen Landwirtschaftsbetrieben ab 2024 verlangen: Mindestens 3,5 Prozent der Ackerfläche muss mit Biodiversitätsförderflächen belegt sein. Sonst ist der Ökologische Leistungsnachweis (ÖLN) nicht erfüllt.
Während der Schweizer Bauernverband und die SVP Sturm dagegen liefen und nach der Niederlage im Bundesrat am 13. April auch Vorstösse im Parlament organisierten, hörte man seitens Bio Suisse kein Wort des Protests.
Bio Suisse war ausdrücklich dafür
Vielmehr schrieb der Bioverband in der Vernehmlassung zu den 3,5%, er sei dafür, denn es brauche mehr Fläche, und er sei mit den Kriterien (welche Flächen können angerechnet werden?) einverstanden. Jetzt aber verlangt Bio Suisse die Verschiebung von 2024 auf 2025 und dass auch sonst Diverses geändert wird.
An der Landwirtschaftskammersitzung wurden die Details bekannt, die nun in die Stellungnahmen von Bio Suisse und SBV zum Agrarpaket 2023 einfliessen. Bio-Suisse-Präsident Brändli hatte dies an der Delegiertenversammlung der Bio Suisse vom Dienstag angekündigt.
Quasi ein Bonus für Bio und IP-Suisse
Der Antrag der Bio Suisse wurde von der Laka, dem rund hundertköpfigen «Parlament» des Schweizer Bauernverbandes, oppositionslos angenommen. Darin heisst es, dass folgendes zu überprüfen und zu korrigieren sei:
- Zusätzliche anrechenbare Massnahmen
- Höhe der Beiträge
- Berechnungsgrundlage, Anrechenbarkeit offene Ackerfläche, Ackerfläche, Kunstwiese
- Berücksichtigung von Produktionssystemen mit zertifizierter Biodiversität
Bei letzterem geht es darum, dass Bio Suisse mit Verweis auf Studien meint, dass ihre Produktion für die Biodiversität ohnehin viel besser ist als die konventionelle Form, Und dass Bio bei der Fläche quasi einen Bonus kriegen solle, sodass ein Biobetrieb (und eventuell auch ein IP-Suisse-Betriebe) nicht 3,5% der Ackerflächen für die Biodiversität reservieren muss, sondern weniger.
Begründung
Die Begründung im Antrag von Bio Suisse lautet wie folgt (sie ist hier im Wortlaut wiedergegeben):
- Wirksame und effiziente Massnahmen können nicht an die 3.5 Prozent BFF im Acker angerechnet werden (z. B. Untersaaten, Agroforst, Obstbäume, Hecken etc.)
- Kollision mit Massnahmen in laufenden Projekten, deren Elemente nicht anrechenbar sind , z. B. Vernetzungsprojekte, Landschaftsqualitätsmassnahmen in Ackerbasugebieten, (z. B. Ackerbegleitflora)
- Frage der Berechnugsbasis der 3.5 Prozent, die selbst Agridea fehlerhaft wiedergibt
Nicht zielführende Folgen:
a) Umbruch von Naturwiesen, extensiven Wiesen und extensiven Wiesen (evtl. Weiden, Anmerkung der Redaktion) mit Qualität zur Erfüllung der 3,5%-Anforderung
b) Verlust von dringend gesuchten Bio-Ackerflächen
c) Problematisches Unkrautdepot in Brachen und Blühstreifen: Parzellen…
… sind im herbizifreien Biolandbau schwierig wieder in Fruchtfolge zu integrieren
… müssen bei IP- und konventionellen Betrieben über mehrere Jahre mit (zusätzlichen) Herbizidbehandlungen kontrolliert werden.
«Einsicht kommt etwas spät»
Beim Mittagessen nach der Laka in Landquart GR hiess es am Apéro, die Einsicht von Bio Suisse komme etwas spät. Denn da die Abstimmung im Parlament zur Motion von Beat Rieder (Mitte) und Marco Chiesa (SVP) sehr knapp ausgegangen sei, wäre ein anderes Resultat möglich gewesen, wenn Bio Suisse diese Bedenken schon damals geäussert hätte. Die Motionen wollten diese Klausel kippen, sie scheiterten an einigen FDP-Stimmen, während SVP und Mitte und Teile der FDP sie unterstützten.
Bio Suisse sei eben in der Regel für jede Verschärfung der Umweltauflagen zu haben, die von den Umweltverbänden und den Grünen in der Bundesverwaltung lanciert werde. Es hiess es auch, es sei ja schön, wenn es am Ende der Diskussion, wenn es an die Umsetzung gehe und auch die Biobetriebe bestes Ackerland mit Buntbrachen besäen müssten, alle die Schwierigkeiten sähen. Urs Brändli hat an der Laka gesagt, es sei kein Hütt und Hott, diese Kritik weise er zurück.



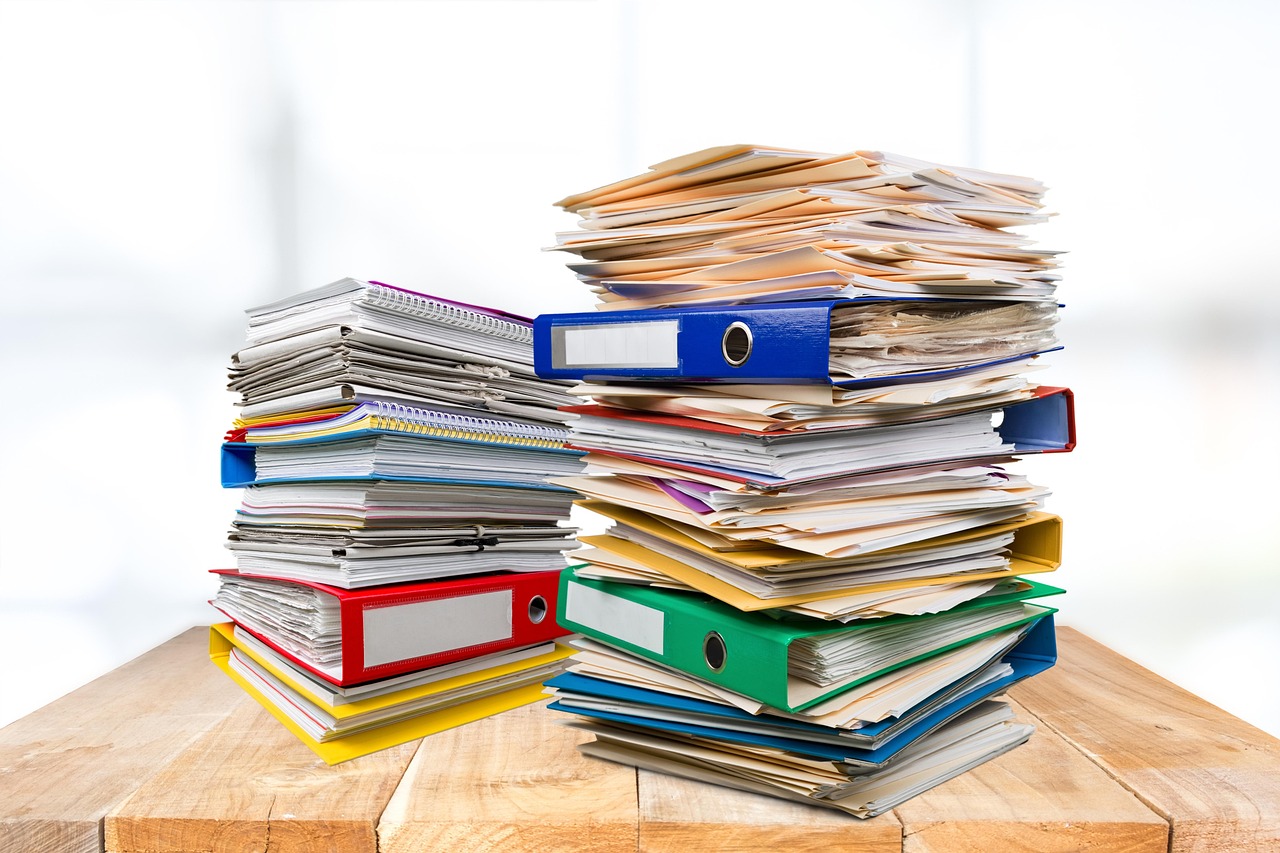
Sie hören sich gerne selber Reden, wenn Sie nur hören würden was sie Reden.
Die landwirte erfüllen bereits schon mehrfach wirksame BFF massnamen. Fruchtbares ackerland mit blumenstreifen (und jeder menge hartnäckiger unkräuter) dafür zu opfern ist völliger unsinn. Herbizide lassen grüssen!