ZHAW-Forschende in Wädenswil ZH haben das theoretische Potenzial für die Stromproduktion mit Agri-Photovoltaik in der Schweiz neu ermittelt. «Dieses beträgt mehr als 300 Terawattstunden – und ist somit fünf Mal so gross wie der heutige Strombedarf der Schweiz», heisst es in einer Mitteilung.
Dies wurde im Rahmen des EDGE-Projektes ermittelt, das durch das Förderprogramm SWEET «SWiss Energy research for the Energy Transition» des Bundesamts für Energie gefördert wird.
Was ist Agri-Photovoltaik?
Getreide, Obst oder Gemüse ernten und darüber oder dazwischen Strom produzieren. Agri-Photovoltaik bezeichnet die Kombination von landwirtschaftlicher Produktion mit der Stromgewinnung durch Photovoltaik.
Acker vor Grasland und Weideflächen
«Das mit Abstand grösste theoretische Potenzial für Agri-Photovoltaik besteht auf offenen Ackerflächen (225 Terawattstunden pro Jahr), gefolgt von Grasland und Weideflächen mit 85 Terawattstunden pro Jahr», berichten die Forschenden.
Das kleinste theoretische Potenzial von 13 Terawattstunden pro Jahr umfasst laut der ZHAW die Kombination mit Dauerkulturen wie Reben, Obstanlagen oder Beerenkulturen. Mit 6 bis 8 Rappen pro Kilowattstunde seien die Gestehungskosten des Stroms tief.
Der Winterstromanteil ist sogar leicht höher als bei Photovoltaik-Anlagen auf Dächern im Mittelland, weil bifaziale Module eingesetzt werden, welche die Einstrahlung beidseitig für die Stromproduktion nutzen.
Positive Auswirkungen nachweisen
Angesichts des Mangels an praktischer Erfahrung in der Schweiz über die Vorteile des Einsatzes von PV für die landwirtschaftliche Produktion wurden nur wenige Einschränkungen hinsichtlich der Art der Kulturen gemacht, die auf dem PV-Acker angebaut werden können. Das berechnete Potenzial stellt daher ein maximales theoretisches Potenzial dar, während das praktische Potenzial weitaus geringer sein kann.
«Die positiven Auswirkungen auf die Landwirtschaft müssen nachgewiesen werden, bevor ein Roll-out dieser Art von Anlagen empfohlen werden kann, denn nach geltendem Recht soll Agri-Photovoltaik die landwirtschaftliche Produktion nicht schwächen oder gar verunmöglichen», heisst es in der Mitteilung.
Produktion könnte profitieren
Einigen Studien deuten darauf hin, dass die landwirtschaftliche Produktion im Gegenteil von der Kombination mit Photovoltaik-Anlagen profitieren soll: Werden Photovoltaik-Module senkrecht auf Gras-, Weide- oder Ackerland montiert, so kann die Erosion der Böden und in heissen Sommern die Verdunstung beziehungsweise das Austrocknen der Kulturen reduziert werden. Weidetiere finden im Schatten der Module Schutz vor der Hitze. Wenn die Module oberhalb der landwirtschaftlichen Kulturen angeordnet werden, zum Beispiel über Gemüse oder Reben, sind die Kulturen vor Starkregen geschützt und das Wasser kann für eine Bewässerung bei Trockenheit gesammelt werden.
Zudem zeigen erste Versuche der ZHAW, dass bei Reben der Befall mit bestimmten Pilzkrankheiten abnimmt, sodass Pflanzenschutzmittel eingespart werden können.
«Sinnvolle Synergien nutzen»
Die Einflüsse auf die landwirtschaftliche Produktion können sehr vielfältig sein. «Mit unserer Forschung möchten wir diese Einflüsse auf die Schweizer Landwirtschaft genauer analysieren und quantifizieren. Dank der wissenschaftlich fundierten und zielgerichteten Nutzung von Agri-Photovoltaik lassen sich sinnvolle Synergien nutzen», laut Mareike Jäger, Dozentin für Regenerative Landwirtschaftssysteme an der ZHAW.
Agri-Photovoltaik soll keine Konkurrenz und erst recht kein Ersatz von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern sein, sondern eine sinnvolle Ergänzung. «Der Ausbau der Photovoltaik erfolgt in der Schweiz bisher viel zu langsam, deshalb müssen wir zusätzlich zu Dachanlagen auch Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit landwirtschaftlicher Produktion und in den Alpen bauen», ergänzt Jürg Rohrer, Dozent für Erneuerbare Energien an der ZHAW. Bereits die Nutzung eines kleinen Teils des theoretischen Potenzials genüge, um den Ausbau zu beschleunigen. «Die Landwirtschaft kann damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig profitieren», so Rohrer.
Die Publikation veröffentlichten Forschungsarbeiten seien mit Unterstützung des Schweizerischen Bundesamtes für Energie im Rahmen des SWEET-Konsortiums EDGE durchgeführt worden. Die Autorinnen und Autoren tragen die alleinige Verantwortung für die in dieser Veröffentlichung dargestellten Ergebnisse und Schlussfolgerungen, heisst es in der Mitteilung.



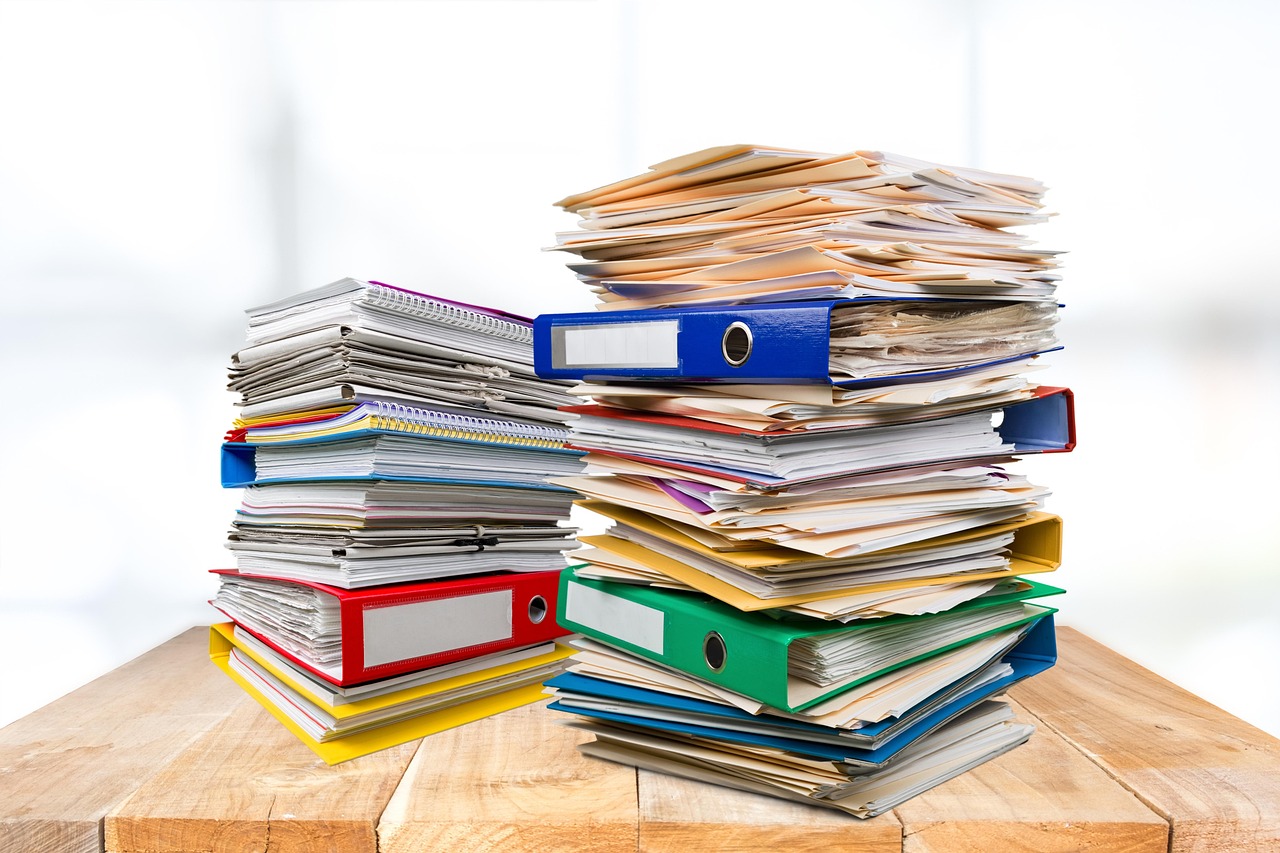
Guten Tag
Geht es ihnen auch so, ewig die gleichen Argumente und
dann noch mit falschem Inhalt zu lesen, ist recht ermüdend.
1. Windenergieanlagen haben ein gewisses Potential an richtig plazierten Standorten, das weiss eigentlich auch Anton Suter.
2. Windenergieanlagen liefern am meisten Strom im Winterhalbjar, wenn es auch weniger Sonnenschein hat.
3. Man kann die Anlagen noch ihrer Lebenszeit wieder abbauen, mit wenig Müll bis jetzt.
4. Inzwischen werden sogar Holzrotoren und Holztürme getestet.
5. Wie viel Zeit bleibt uns eigentlich noch, um uns enerigautark zu machen? Weg vom schutzigen Erdöl und strahlendem Uran aus Russland?
6. Stromspeicher gibt es herkömmliche, welche dann anders eingesetzt werden müssen und bald auch überall neue. Die Entwicklung läuft rasant. Wollen danebenstehen und jammern?
Mit der aktuellen Batterietechnologie ist es NICHT möglich, Saisonspeicher zu betreiben. Es grenzt an Denkverweigerung, zu behaupten der Ersatz der fossilen Energieträger könne mit Wind oder Sonne gemacht werden. Nur mit Kernenergie können grosse Mengen von Fossilen ersetzt werden.
Uran wird auch in Kanada, Australien, Afrika etc. abgebaut. Thorium kann ebenfalls genutzt werden, Vorkommen in USA, Australien, Indien, Brasilien. Die Weiterentwicklung der Kernenergie verspricht sicherere und wesentliche effizientere Reaktoren.
Deutschland zeigt in Echtzeit, was passiert, wenn ideologische Extremisten in der Regierung sitzen.
Fazit: Wind und Sonne an guten Standorten mögen zeitweise eine gute Ergänzung darstellen, aber kaum eine alleinige durchgehende Energieversorgung sicherstellen.
Woher kommt der Nachtstrom an die X Ladestationen für die hochfahrende E-Mobilität ?
Meiner Meinung nach sollten nur bedarfsgerechte Anlagen für den Eigenverbrauch realisiert werden, wenn das Budget stimmt.
Die graue Energie für Grossanlagen von Flatterstrom, (Herstellung von Aluminium und Glas), wird ausgeblendet; ist weder ökologisch noch nachhaltig, da die Lebensdauer der Anlagen nicht einmal bekannt ist.
Und wer garantiert mir während der Amortisationsdauer einen kostendeckenden Einspeisetarif?
Bin schon mit der PV Anlage auf dem Scheunendach aus 2013 reingelegt worden, statt den benötigten 22,6 nach Abzug der Einmalvergütung, bmhabe ich bis heute im Schnitt nur 11,6 Rappen erhalten, bedeutet einen Verlust von fast 50%
Grün ist das neue Synonym für Dummheit.
Unsere Wiesen und Äcker versauen!