Benjamin Dechant vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig war an der Publikation der südkoreanischen Forschungsgruppe beteiligt und erklärt im Interview die wichtigsten Ergebnisse.
Wenn es ungewöhnlich heiss und trocken ist, verschieben Pflanzen den Schwerpunkt der Photosynthese in die Morgenstunden. Wieso ist diese Erkenntnis wichtig für die Forschung?
Obwohl diese Erkenntnis an sich nicht neu ist, beruhte sie bislang auf kleinräumigen Studien an einzelnen Pflanzenarten beziehungsweise Ökosystemen, etwa auf der Ebene eines Waldbestandes, und konnte bisher nicht grossräumig mit Satelliten beobachtet werden. Die neue Studie ist die erste, die flächendeckend für den kontinentalen Teil der USA diese Verschiebung in Richtung der Morgenstunden auf der Basis von Satellitenmessungen quantifiziert. Die Ergebnisse können unter anderem verwendet werden, um Simulationsergebnisse von Vegetationsmodellen zu evaluieren und zu verbessern, was wichtig für Vorhersagen des globalen Kohlenstoffzyklus ist.
Mit zunehmender Erderwärmung wird das Phänomen der verschobenen Photosynthese-Aktivität voraussichtlich häufiger auftreten. Welche Folgen kann das für einzelne Pflanzen, aber auch für ganze Ökosysteme haben?
Für die Photosynthese müssen Pflanzen die Spaltöffnungen in den Blättern öffnen, dabei verdunstet Wasser. Für einzelne Pflanzen ist es bei Dürren und Hitzewellen wichtig, den Wasserverlust zu minimieren und dabei trotzdem noch ein minimales Mass an Photosynthese aufrechtzuerhalten. Wenn solche Bedingungen allerdings länger anhalten und die Pflanzen nicht ausreichend Wasser über die Wurzeln aufnehmen können, kann dies zu verstärktem Absterben von Pflanzen führen, besonders bei Arten, die nicht an solche extremen Umweltbedingungen angepasst sind.
Auf der Ebene von Ökosystemen kann die stark reduzierte Verdunstung von Wasser aus den Blättern zu späteren Tageszeiten auch einen Einfluss auf die Temperaturen haben, da der kühlende Effekt der Verdunstung viel geringer ist als unter Normal-Bedingungen. Das könnte sich unter anderem negativ auf die Tiere auswirken, die in solchen Ökosystemen leben, und kann sich natürlich auch in Städten bemerkbar machen. Auch kann es teilweise zu Rückkopplungseffekten kommen, bei der sich Dürren durch die reduzierte Verdunstung noch weiter verstärken.
Die Forschungsgruppe, an der Sie mitgewirkt haben, hat für die Studie Daten von geostationären Satelliten ausgewertet, die sich immer über demselben Punkt der Erdoberfläche befinden. Was macht diese Satelliten so wertvoll für Ihre Forschung?
Geostationäre Satelliten werden schon seit Jahrzehnten für Kommunikationszwecke sowie Wetter-Beobachtung und -Vorhersagen eingesetzt, aber waren für die Vegetationsforschung nur bedingt nutzbar. Die neueren geostationären Satelliten wurden mit Sensoren ausgestattet, die auch die für die Vegetationsbeobachtung notwendigen Teile des elektromagnetischen Spektrums abdecken.
Obwohl die räumliche Auflösung dieser geostationären Satelliten nicht so hoch ist wie die «konventioneller» Satelliten, haben sie den großen Vorteil von sehr hohen zeitlichen Auflösungen im Bereich von 5 Minuten bis einer Stunde. Das ermöglicht es, relevante Messungen kontinuierlich im Verlauf eines Tages durchzuführen, was sonst eigentlich nur mit Messtürmen auf der Erdoberfläche möglich ist.
Forscherinnen bekommen mit dieser Technologie auch deutlich mehr wolkenfreie Messungen. Dies ist auch für Studien auf der saisonalen Zeitskala, etwa zur Pflanzenphänologie, wichtig und macht sich besonders stark in Regionen mit vermehrter Wolkenbedeckung wie den Tropen bemerkbar, die ja für den globalen Kohlenstoffzyklus eine sehr wichtige Rolle spielen.
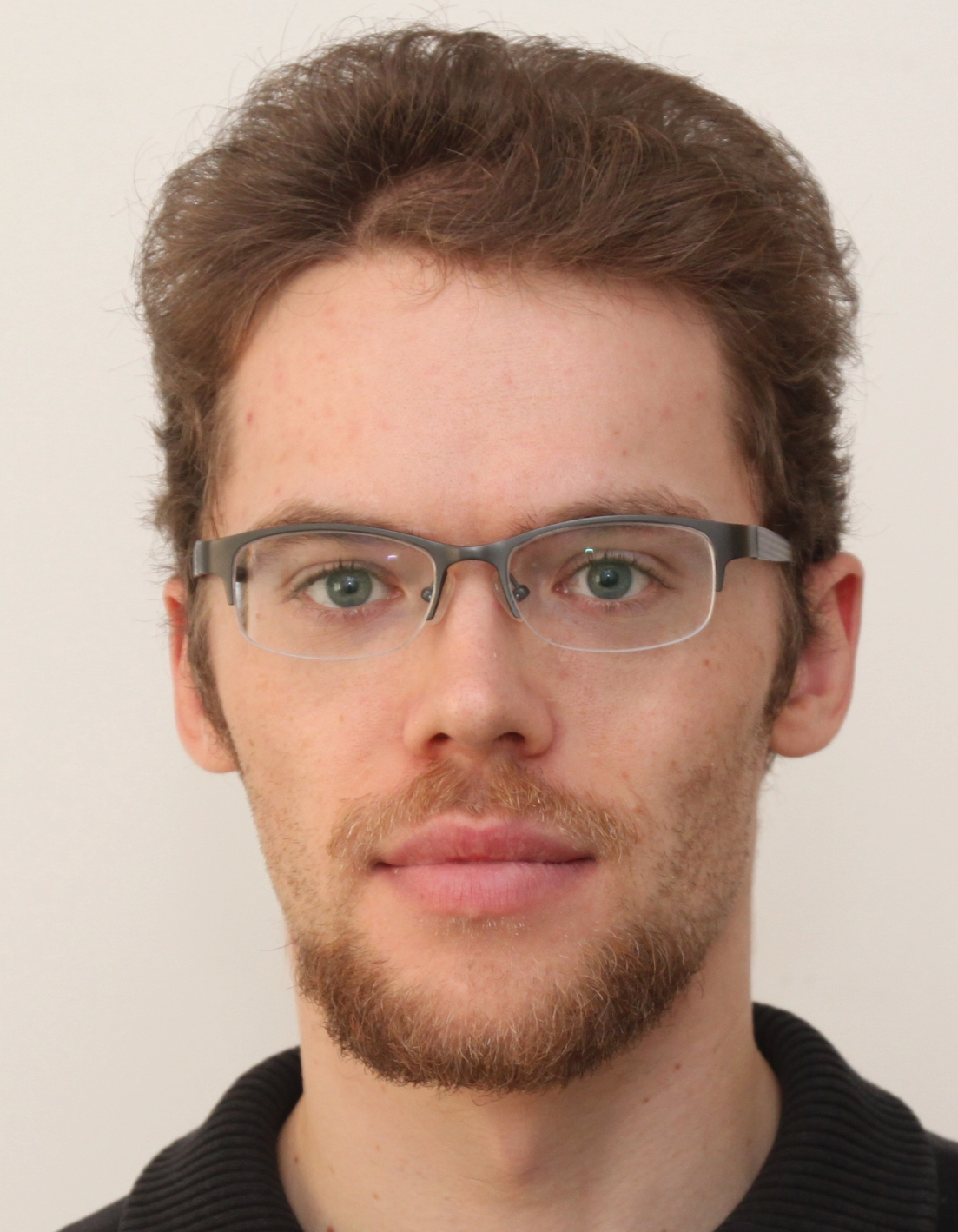
Dr. Benjamin Dechant
zvg



