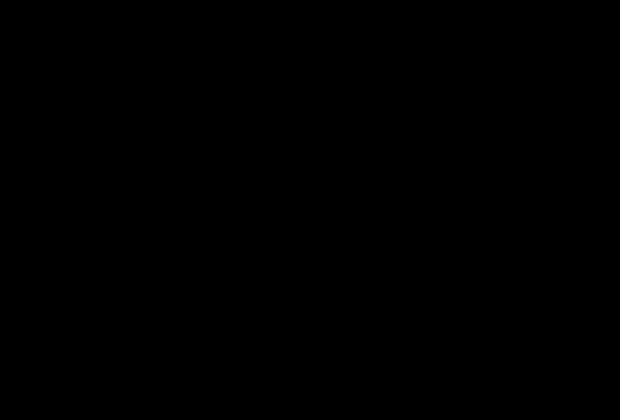Daniel Salzmann, stellvertretender Chefredaktor des "Schweizer Bauer", bloggt über einen Besuch an der Weltausstellung in Milano (I). Folgende Bilder sind Salzmann im Kopf hängen geblieben:
Die friedliche Menschenmenge unter den Sonnensegeln
Die Expo ist sehr gut besucht. Wir kamen aber um 11 Uhr ohne Anstehen durch die Sicherheits- und Billettkontrolle. Vor den beliebten Länderpavillons bildeten sich einige Schlangen, wie ich es aber auch an der Expo Hannover 2002 erlebt habe. Niemand aber drängte sich vor oder machte Stress. Auf der breiten Flaniermeile ist man unter den Sonnensegeln gut geschützt. Nach 19 Uhr die Überraschung auf dem Weg zum Bahnhof: Viele Menschen wollen mit Abendticket rein. Offenbar gehen an diesem warmen und schönen Abend viele Einheimische dort in den Ausgang.
Die Wiediker Rostbratwurst im Schweizer Pavillon
Die Schweizer Snack-Bar „Terrazza“ war am Samstag sehr gut besucht. Das Schweizer Restaurant allerdings liegt versteckt auf dem Pavillon, sein Intérieur strahlt eher Kälte aus. Hoch erfreulich war aber die Zürcher Spezialität, die gerade im Angebot war: Die Wiediker Rostbratwurst von der Stadtzürcher Metzgerei Keller. Sie war sehr fein. Ebenso die Pizzoccheri, die meine Frau kostete. Und bei der elektronischen Speisekarte ist das Schweizer Quiz witzig. Erst im dritten Anlauf schaffte ich es mit 12 richtigen Antworten auf 12 Fragen auch zum „echten Eidgenossen“…
Der erhobene Zeigefinger im Schweizer Pavillon
Der Schweizer Pavillon ist durchdacht. Für die Lebensmittel-Türme gibt’s ein Ticket mit Uhrzeit, sodass die Besucher nicht an der prallen Sonne warten müssen. Mit der Gotthard-Ausstellung und den Städte-Ausstellungen (aktuell Zürich) gibt es weitere Attraktionen, ebenso mit der Wand aus der Verkehrshaus, in der eine Kugel eine Reise durch die Schweiz macht. Gleich daneben liegt die Terrazza, die Snack-Bar, wo die Besucher unter dem Schatten von Bäumen ein Raclette geniessen können.
Aber verglichen mit der Extravaganz, der Frechheit, der Coolness anderer Pavillons wirkt der Schweizer Pavillon etwas brav. Schade ist, dass nicht auch für die Türme Holz verwendet werden durfte. Aus Metall wirken sie kühl. Überhaupt machen andere Länder ungeniert Werbung für die Leistungsfähigkeit ihrer Land- und Ernährungswirtschaft, während die Schweiz den Zeigefinger hebt: „Nehmt nicht zuviel mit, sonst hat es nicht für alle.“
Der noch immer fast volle Schweizer Kaffeeturm
Die Apfelringli der Schweizer Landwirtschaft gingen in den ersten Tagen der Expo weg wie warme Weggli. Ein Viertel verschwand innerhalb von vierzehn Tagen. Rund einen Monat lang konnte man deshalb keine Apfelringli mitnehmen. Denn beim Kaffee (Nescafé von Nestlé) und beim Salz (Alpensalz aus Bex VD) geht alles langsamer vonstatten. Dort sind noch heute, nach rund zwei Monaten, mehr als drei Viertel vorrätig (exakt 86%). Trotzdem sind jetzt die Wasserbecher und die Apfelringli wieder zugänglich, der Schweizer Pavillon musste sein Konzept anpassen.
Die Leistungsschau von Israel
Grosse Bildschirme mit hoher Auflösung sind an der Expo gross in Mode. So auch im Pavillon von Israel. Das junge Israel begrüsst einen mit einer Einschaltung aus einer Party in Tel Aviv. Zwei Filme informieren über die Erfolge der israelischen Landwirtschaft in der Wüste und über die Exporte der israelischen Agrartechnologie (u.a. Bewässerung, Pflanzenzucht, IT). Präsentiert wird das Ganze von einer jüdischen Schönheit, die alles mit ihrer (angeblichen) Familiengeschichte in Verbindung bringt. Politisch korrekt wird am Ende, wo es heisst, wie Israel sich über die Landtechnik für ein besseres Leben von allen Menschen auf der Welt einsetzt, auch eine Muslimin mit Kopftuch eingeblendet.
Die vertikale Farm der USA
Im US-Pavillon empfängt einen Präsident Obama höchstpersönlich – auf einem Bildschirm. Und spricht über die 9-Milliarden-Welt im Jahr 2050. Das Spektakuläre ist aber seitlich am Pavillon zu sehen: Eine vertikale Farm. Auf 860 Quadratmetern wachsen dort 40 Gemüse, Getreide und Kräuter. Auf einer Info-Tafel liest man: Eine vertikale Farm brauche 70% weniger Wasser und bis zu dreissig Mal weniger Agrarfläche. Sie sei deshalb eine wichtige Technologie für die zukünftige Lebensmittelproduktion – Stichwort Ressourceneffizienz kommt mir da in den Sinn.
Die Spendenbox beim nepalesischen Pavillon
Nepal präsentiert typische Architektur. Im Zentrum steht aber eine Glasbox, in der man Geld für das am 15. April von einem starken Erdbeben gebeutelte Land spenden kann. Und es hat viele Nötli und Münzen drin! Fertiggestellt wurde der Pavillon übrigens von Freiwilligen, weil das Land nach dem 15. April für den Pavillon kein Geld mehr hatte.
Die Propaganda des thailändischen Königs
Thailand zeigt auf einem riesigen 360-Grad-Bildschirm wunderschöne Bilder seiner Landschaft, welche die Landwirtschaft zeigen, aber wohl vor allem den Tourismus ankurbeln sollen. Gleich drei Bildschirm-Präsentationen folgen aufeinander. Die letzte ist ganz auf den thailändischen König ausgerichtet. Persönlich kümmere er sich um die Fortschritte in der thailändischen Landwirtschaft. Höhepunkt der fast unerträglichen Königs-Propaganda ist: Ein kleines Mädchen fragt: Wo ist der König? Ihr Vater antwortet: Sein Geist ist überall zu spüren.
Die 20‘000 LED-Leuchten im chinesischen Pavillon
China ist zum ersten Mal an einer Weltausstellung mit einem eigenem Pavillon präsent. Es macht mit ausgefallener Architektur auf sich aufmerksam und zeigt den Besuchern zuerst die Ursprünge seiner Landwirtschaft, die alten Lehrbücher und Bilder von Leuten, die mit ihren Händen die Äcker bearbeiten. Dann folgt der Blick hinunter auf 20‘000 LED-Leuchten, die andauernd ihre Farben wechseln und neue Muster zeigen. Was aber eigentlich dargestellt wird, bleibt offen. Angeblich ein Blumenfeld, erkennen konnte ich jedenfalls keine Blumen. Die Hauptsache scheint: Raffinierte Technik, die von Modernität zeugt.
Die 1300 italienischen Weine
Im italienischen Bereich stand gleich an zwei Orten angeschrieben, dass man 1300 italienische Weine degustieren könne. Zu welchem Preis, war auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Leider reichte die Zeit nicht mehr, um dem Angebot nachzugehen. Chianti und Barolo müssen warten – bis zum nächsten Expo-Besuch? Weit ist es ja wirklich nicht nach Milano. Der Extrazug von Bern an die Expo braucht nur drei Stunden.