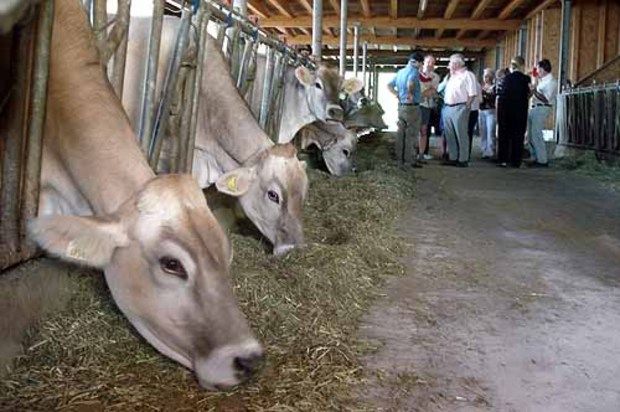Mit GMF hat die Frage nach der Kraftfuttermenge bei Milchkühen an Bedeutung gewonnen. Studien zeigen, dass die Bauern Kraftfutter mit Mass einsetzen. Zwischen den Betrieben gibt es aber Unterschiede.
Auswertungen der Vollkostenrechnungen zeigen, dass die Schweizer Bauern viel Geld für Kraftfutter ausgeben. Bei einem Betrieb im Talgebiet werden etwa die Hälfte bzw. 11 Rappen pro kg Milch durch das Kraftfutter verursacht. Die Betriebe zielen deshalb eine hohe Futterautonomie bei möglichst ausgeglichenen Rationen an. Das wird umso schwieriger, je weiter die Milchproduktion einer Intensivierung und Spezialisierung unterliegt.
Die Betriebe produzieren zwar mehr Milch und die Herdengrössen steigen, aber die verfügbaren Futterproduktionsflächen wachsen nicht im gleichen Masse mit. Somit wird es für die Betriebe zunehmend schwieriger, beim Futter eine hohe Eigenversorgung aufrecht zu erhalten, und es muss vermehrt Kraftfutter eingesetzt werden. Seit 1990 hat sich die eingesetzte Kraftfuttermenge pro Tier mehr als verdoppelt, während im gleichen Zeitraum die mittlere Milchleistung pro Kuh und Jahr nur von 5000 auf 7000kg angestiegen ist.
Kraftfutter ist physiologisch wichtig
Neben wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten ist der gezielte Einsatz von Kraftfutter auch aus physiologischer Sicht wichtig. Die Kuh ist ein Wiederkäuer, hohe Kraftfuttergaben können einen Teil des Grundfutters aus der Ration verdrängen. Zudem beeinflusst die Kraftfuttermenge den pH-Wert des Pansens und das Gleichgewicht der Pansen-Bakterien und kann bei hohen Mengen zu Störungen im Stoffwechsel wie etwa Pansenazidose führen.
Drei Studien aus den Jahren 2002 bis 2013 – also vor Inkrafttreten der AP 14–17 mit dem Programm zur graslandbasierten Milch- und Fleischproduktion (GMF) – liefern einen Überblick über die eingesetzten Kraftfuttermengen und das Milchproduktionsniveau:
- Interreg-Projekt Jura «Wirtschaftliche Milchproduktion»: Die Projektstudie aus dem Jura zeigt, dass der Einsatz von Kraftfutter sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dass sich kein direkter Zusammenhang zwischen der verfütterten Kraftfuttermenge und der produzierten Milchmenge ableiten lässt. Im Gegensatz zu Dürrfutterbetrieben hatte bei Silagebetrieben die eingesetzte Kraftfuttermenge einen entscheidenden Einfluss auf den wirtschaftlichen Betriebserfolg. Bei Silagebetrieben könnte also durch einen gezielteren Kraftfuttereinsatz eine Verbesserung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses erzielt werden. Innerhalb der Stichprobe heben sich die Biobetriebe durch einen deutlich geringeren durchschnittlichen Kraftfuttereinsatz von 72g/kg produzierter Milch ab.
- Studie der Hafl zu Rationszusammensetzung und Futterautonomie von Schweizer Milchproduktionsbetrieben: Für diese Studie wurden 157 Betriebe in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen in der Tal-, Hügel- und Bergzone untersucht. Auch hier wurden beim Kraftfuttereinsatz grosse Unterschiede zwischen den Betrieben festgestellt. Bei den Silagebetrieben hat beispielsweise der Betrieb mit dem höchsten Kraftfuttereinsatz fünfmal mehr eingesetzt als jener mit der tiefsten eingesetzten Kraftfuttermenge. 24 Betriebe wurden in der Folge genauer unter die Lupe genommen, und bei ihnen wurden Futterproben analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass die Qualität des Raufutters ein entscheidender Faktor für den Kraftfuttereinsatz bei Dürrfutterbetrieben darstellt.
- Studie zum Milchproduktionspotenzial in Abhängigkeit der Futterfläche: Die dritte Studie wurde zwischen 2002 und 2009 im Kanton Freiburg mit 266 Betrieben durchgeführt. Auch hier gab es grosse Unterschiede in der Effizienz des Kraftfuttereinsatzes. Innerhalb einer Gruppe mit ähnlichen Milchleistungen von etwa 8000kg findet man bei den Kraftfuttermengen enorme Unterschiede: 64 bis 280g Kraftfutter pro kg produzierter Milch (117g im Durchschnitt). Damit ist die grösste eingesetzte Kraftfuttermenge um den Faktor 4,5 grösser als die tiefste eingesetzte Kraftfuttermenge.
Spielraum für Reduktion bleibt
Betrachtet man diese Studien, so wird klar, dass in gewissen Systemen noch Spielraum für die Reduktion der eingesetzten Kraftfuttermengen vorhanden ist. Zusammenfassend zeigen die beiden Studien aus dem Jahr 2013 einen moderaten Kraftfuttereinsatz von weniger als 150g/kg produzierter Milch, und dies noch vor der Einführung der AP 14–17 und GMF.
Die schweizerische Besonderheit, Milch primär auf der Basis von Wiesenfutter zu produzieren, wird also eindrücklich bestätigt. Die Schweizer Milch kann durch dieses Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt einen Konkurrenzvorteil erzielen.
*Fabienne Gresset arbeitet bei der Agridea, Pascal Python und Franz Sutter arbeiten bei Profi-Lait.