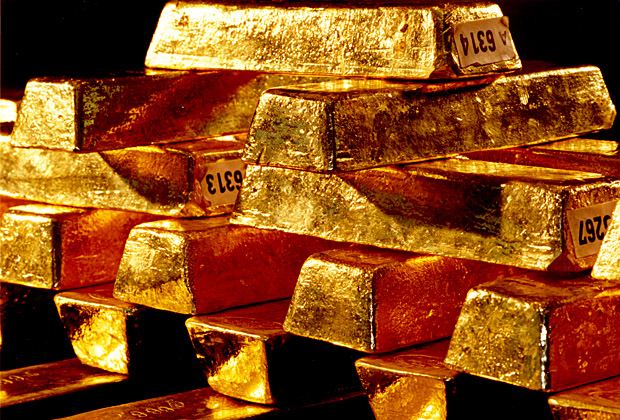Goldsucher aufgepasst: ETH-Forscher haben mit Hilfe eines Computermodells aufgeklärt, wie reiche Gold- oder Kupfererz- Lagerstätten entstehen. Das gleiche Modell bildet umgekehrt auch die Vorgänge bei der Erschliessung von Tiefenwärme zur Energiegewinnung ab.
Porphyrische Erzlagerstätten sind die reichsten Vorkommen von Gold, Kupfer oder Molybdän, wie die ETH Zürich am Dienstag mitteilte. Mit ihrer Computersimulation hat die Gruppe von Christoph Heinrich an der ETH Zürich nun erstmals die physikalischen Vorgänge ihrer Bildung rekonstruiert.
Es braucht dazu eine Magmakammer unterhalb eines aktiven Vulkans. Aus dem Magma werden metall- und salzreiche wässrige Lösungen, sogenannte Fluide, ausgestossen. Der Druck in der Magmakammer presst die Fluide wie durch ein Sieb durch einen geäderten Vulkanschlot nach oben, wie die Forscher im Fachblatt «Science» berichten.
Lagerstätte in Pilzform
Auf einer bestimmten Höhe, nämlich etwa zwei Kilometer unter der Erdoberfläche, werden die Metalle ausgefällt und angereichert. Das Erzlager erhalte dadurch eine typische Pilzform: Der «Stamm» ist der Vulkanschlot, das Erzlager der «Hut», schreibt die ETH.
Rund 50'000 Jahre dauere es, bis die Magmakammer ihr Fluid ausgestossen hat. Temperatur und Druck des Fluids bestimmen die Erzablagerung: Fallen beide ab, sind die Metalle weniger löslich. Diese Faktoren bestimmen somit die Grösse, Form und Erzgehalt der Lagerstätten, schreiben die Autoren.
Das «Schöne am Modell» sei, dass es genau zeige, wie sich das Vulkansystem spontan organisiert und wie sich Metalle bis zu den in der Natur beobachteten Erzgehalten anreichern, erklärte Erstautor Philipp Weis. Würden sich die Metalle querbeet durch die Erdkruste verteilen, entstünde nie eine nutzbare Lagerstätte.
Gilt auch für Tiefenwärme-Gewinnung
Besonders spannend ist das Modell, weil es mit umgekehrten Vorzeichen auch die Prozesse bei der Nutzung von Tiefenwärme abbildet. Dabei wird Wasser unter hohem Druck in die Tiefe gepresst, wo es von der Erdwärme erhitzt wird und zur Nutzung zurück an die Oberfläche transportiert wird.
Der Druck öffnet Risse und Poren im Gestein, erst dann kann das Wasser durch den heissen Fels strömen. «Dieses Zusammenspiel von Fluid und Gestein ist mit dem Erz-System vergleichbar», erklärte Mitautor Thomas Driesner. Er und seine Doktoranden tüfteln nun am Modell weiter, um es für die Erschliessung der tiefen Geothermie anzuwenden.
Denn wenn die Poren zu gross werden, erhitzt sich das Wasser zu wenig. Sind sie zu klein, fliesst das Wasser nicht hindurch. «Es ist noch viel Forschung nötig, bis dieses System kontrolliert werden kann», betonte Weis. Computermodelle wie ihres könnten für die Energieproduzenten die optimalen Bedingungen vorausberechnen.