Vegane oder vegetarische Mahlzeiten liegen im Trend. Der Schweizer Bauernverband will, dass die Schweizer Bauern davon profitieren können. Dazu müssten aber die Produzentenpreise steigen. Wäre die Produktion von Hafer und Linsen für Sie eine Option? Oder kommt das für Sie nicht infrage? Abstimmen und mitdiskutieren
Der Ackerbau spielt im Mittelland eine wichtige Rolle – und bietet den Produzenten neue Chancen. Der Schweizer Bauernverband (SBV) hat diese in einem neuen Bericht «Potenzial ausgewählter Ackerkulturen in der Schweiz» festgehalten.
Rückgang pflanzlichen Produktion
David Brugger vom SBV sagt zu «Schweizer Bauer»: «Der Pflanzenbau generell ist enorm wichtig für die Bauern. Knapp 40 Prozent des landwirtschaftlichen Produktionswerts stammen daraus. Oft wird die Landwirtschaft auf Fleisch, Milch und Eier reduziert.»
Der Bericht solle zeigen, was der Ackerbau leisten könnte und wo die Herausforderungen liegen. «Obwohl es einen Trend gibt zu pflanzlicher Ernährung und obwohl die Politik fordert, den Fleischkonsum zu senken, haben wir seit 2014 einen Rückgang in der pflanzlichen Produktion», sagt Brugger. Der Absenkpfad Pflanzenschutzmittel und Nährstoffe verstärkte diesen deutlich. «In der Realität findet also das Gegenteil statt von dem, was von uns verlangt wird», hält er fest.
Bessere Preise vonnöten
Brugger ist sicher, dass die Ernährungstrends neue Perspektiven bieten: «Soja oder Gelberbsen für Fleischersatzprodukte wären gefragt, leider fehlt in der Schweiz die Verarbeitungsindustrie.» Auch der Anbau von Hafer für Haferdrink und Haferflocken oder von Quinoa sowie Buchweizen habe enormes Potenzial, ebenso liessen sich aus Rapsextraktionsschrot interessante Produkte für die Ernährung herstellen, nicht nur im Biosegment.
Leider fehle bei diesen Spezialkulturen oft der Grenzschutz, sie würden sehr günstig als Rohstoffe oder Fertigprodukte importiert. «Wichtig ist, Konsumenten und Verarbeiter bezüglich Herkunft zu sensibilisieren, was zum Teil schon geschieht.» Ziel müsse sein, einen Teil der Wertschöpfung auf die Betriebe zu bringen, denn diese sei bei den Nischenkulturen aktuell sehr schlecht. «Hafer könnte man in der Schweiz schnell viel mehr anbauen, wenn es wirtschaftlicher wäre. Wir müssen hier die Diskussion nach einem Richtpreis führen und beim Grenzschutz systematisch nach Lücken suchen.»
Lupinen sowie Acker- und Stangenbohnen
Gemäss einer Studie der Berner Fachhochschule und Agroscope zum Thema «Pflanzliche Proteine als Fleischersatz» besteht in der Schweiz Potenzial für den Anbau von Eiweisspflanzen für die menschliche Ernährung. Gemäss dieser Studie würden sich für die Proteingewinnung etwa Lupinen sowie Acker- und Stangenbohnen eignen. Für die Verwendung dieser Rohprodukte in der Produktion von pflanzenbasierten Fleischalternativen müssten diese allerdings zuerst zu proteinreichem Mehl, Konzentraten oder Isolaten verarbeitet werden.
Grund für die ausbleibende Produktion ist das Fehlen einer Verarbeitungsindustrie ist in der Schweiz. «Damit die Schweizer Landwirtschaft ebenfalls von diesem Wachstumsmarkt profitieren kann, braucht es einen gesamtheitlichen Blick auf die Wertschöpfungskette von der Produktion der Rohstoffe, über deren Aufbereitung und Verarbeitung bis hin zur gezielten Vermarktung», so die Studie.

Beyond Meat
Fleischersatzprodukte werden gefragter
Nebst den Linsen, Hafer und Co. gibt es eine stetig steigende Nachfrage nach Fleischersatz-Produkten. Gemäss dem ersten Marktbericht Fleischersatz-Produkte von Mai 2021 beträgt die Wachstumsrate bei solchen Produkten jährlich 18,4 Prozent. Dies entspricht seit 2016 nahezu einer Verdoppelung. Im gleichen Zeitraum wuchs der Fleischmarkt (Frischfleisch, Charcuterie, Konserven und Insekten) im Detailhandel jährlich um 2,0 % (Absatz) bzw. 3,0 % (Umsatz).
Basierend auf der Auswertung des kombinierten Retail- und Konsumentenpanels von Nielsen Schweiz betrug der Gesamtumsatz von Fleisch- und Fleischersatzprodukten im Schweizer Detailhandel im vergangenen Jahr 5.43 Mrd. Fr. Davon machten Frischfleisch mit 2.93 Mrd. Fr. und Charcuterie mit 2.27 Mrd. Fr. zusammen über 95 % des gesamten Umsatzvolumens aus. Verglichen mit Fleisch handle es sich bei Fleischersatz mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent im Detailhandel um ein Nischenprodukt.
Detailhandel baut Sortiment aus
Verschiedene Studien prognostizieren für die nächsten Jahre einen weiteren Wachstumstrend für Fleischersatzprodukte. Vor dem Hintergrund des Klimawandels gebe es ein zunehmendes Konsumentensegment, insbesondere bei jüngeren Personen, das bewusst den Fleischkonsum reduziert oder sogar ganz darauf verzichtet, hält das BLW fest.
Von diesem Wachstumsmarkt profitieren zunehmend auch Schweizer Unternehmen aus Handel und Lebensmittelindustrie, die neben Tofu ebenfalls die Entwicklung von Meat-Analog-Produkten vorantreiben, darunter etwa Planted Chicken (Planted), The Green Mountain von Hilcona/Bell (Coop) oder V Love von Micarna/BINA (Migros).
Rohstoffe fast alle importiert
Auf Ebene der landwirtschaftlichen Produktion sei dieser Trend jedoch noch kaum zu sehen, schreibt das BLW. In der Schweizer Landwirtschaft gebe nur ganz vereinzelte Projekte und Initiativen, die den Anbau der notwendigen pflanzlichen Rohstoffe vorantreiben, so beispielsweise das Projekt zum Anbau von Bio-Soja für die inländische Bio-Tofu-Produktion. Ansonsten werden die für die inländische Produktion von Fleischersatzprodukten benötigten pflanzlichen Proteine praktisch ausnahmslos importiert.
Die Firma Planted Foods AG aus Kempthal ZH beispielsweise beschafft das Gelberbsen-Proteinisolat für die Herstellung ihrer Fleischalternativen in europäischen Ländern. «Aus der Schweiz ist dieser Rohstoff gar nicht in den nötigen Mengen verfügbar», sagt Firmenmitbegründer Christoph Jenny. Das Interesse an einer lokalen Produktion sei aber sehr gross. Weshalb gemeinsam mit Partnern das Projekt «Züchtung für die Etablierung Schweizer Erbsen in Landwirtschaft und Ernährung» gestartet wurde, mit der Unterstützung vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Grosse Ertragsschwankungen
Kai Tappolet baut bei sich in Wilchingen SH seit zehn Jahren grüne und schwarze Linsen an. Der Absatz ist kein Problem, eher im Gegenteil, sagte er im März 2021 zum «Landwirtschaftlichen Informationsdienst». Die Nachfrage sei während der Pandemie eher noch gestiegen. Er baut Linsen in einem Dreiergemisch mit Leindotter als Stützfrucht sowie Eiweisserbsen an.
Tappolet drescht und trocknet das Dreiergemisch selbst, ehe er es trennt. Übrig bleiben 200 bis 800 Kilogramm Linsen pro Hektare, die er in einem weiteren Schritt reinigt und kalibriert. Praktisch alles geht in die Direktvermarktung. Weil er die meisten Arbeiten selbst ausführt, bleibt genug Wertschöpfung auf dem Betrieb und am Schluss stimmt es unter dem Strich auch finanziell. Doch der Aufwand sei insgesamt halt schon gross, sagt er. Vor allem wegen den grossen Ertragsschwankungen sind viele Bauernfamilien nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Zumal es keine spezifischen Direktzahlungen für Linsen gebe.
Hohe klimatische Ansprüche
Laut der Branchenorganisation Swiss Granum wuchsen im letzten Jahr in der Schweiz gerade einmal auf 136 Hektaren Linsen. Andere zurzeit angesagte Eiweisskulturen für die Verwendung in der menschlichen Ernährung wären beispielsweise Kichererbsen, Süsslupinen oder Soja. Der Anbau all dieser Kulturen erfordert allerdings relativ hohe klimatischen Ansprüche, die nicht überall erfüllt werden können.
Sie wachsen nur auf den besten Böden. Dort, wo Getreide, Kartoffeln oder Gemüse etabliert sind zum Beispiel. Doch vor allem fürchten die Bauern das Unkraut, gegen das Körnerleguminosen wenig konkurrenzfähig sind. Trotzdem hat sich in den letzten zehn Jahren die Anbaufläche von Soja fast verdoppelt, das einen deutlich höheren Eiweissgehalt als Linsen aufweist.



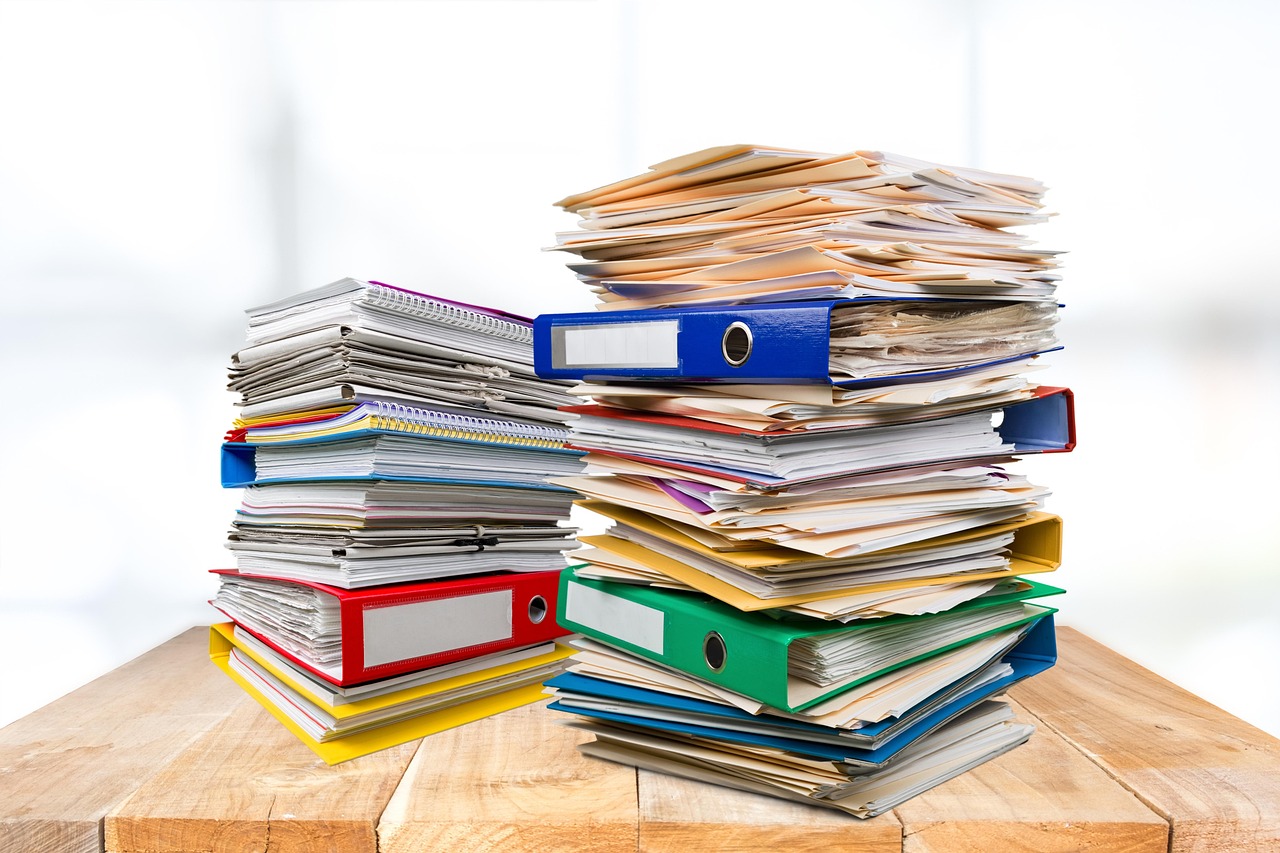
Kommentare (3)