Der Nationalrat empfiehlt die Massentierhaltungsinitiative zur Ablehnung. Die Schweiz tue bereits genug, um das Tierwohl zu fördern, hiess es im Rat mehrheitlich. Die grosse Kammer sprach sich auch dagegen aus, eine Alternative auszuarbeiten.
Die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» will die Massentierhaltung verbieten und die Würde der Tiere in der Landwirtschaft in die Verfassung aufnehmen.
Der Bund müsste Kriterien festlegen insbesondere für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, den Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maximale Gruppengrösse pro Stall. Dafür sollen Anforderungen festgelegt werden, die mindestens denjenigen der Bio-Suisse-Richtlinien von 2018 entsprechen.
Initiative: Übergangsfrist von 25 Jahren
Die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» (Massentierhaltungsinitiative) wurde im September mit 106’000 gültigen Initiativen eingereicht. Diese verlangt, dass spätestens 25 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Gesetze alle Nutztiere in der Schweiz mindestens nach dem Standard der Bio Suisse gehalten werden. Der Bund soll Kriterien für die Unterbringung, den Auslauf, die Anzahl gehaltener Tiere und die Schlachtung festlegen.
Gilt auch für Importe
Dies hätte einschneidende Auswirkungen auf die Nutztierhaltung: Nur noch 2000 Legehennen pro Betrieb, keine künstliche Besamung mehr für Mutterschweine, Anbindehaltung von Kühen nur in Kombination mit Raus-Programm. Pro Schwein ist beispielsweise eine Liegefläche von 1,65 Quadratmetern vorgesehen – bei Nicht-Bio-Betrieben sind es 0,9.
Die Initiative soll für die einheimische Nutztiere gelten, aber auch für Importe. Die Initianten wollen, dass jede Haltung von Tieren, die nicht mindestens den Richtlinien von Bio Suisse entspricht, verboten wird. Die Definition der Massentierhaltung erfolgt über die Gruppengrösse sowie die systematische Missachtung der Grundbedürfnisse der Tiere, heisst auf der Website der Initianten.
Nutztierhaltung nicht abschaffen
Das Initiativkomitee will die Nutztierhaltung aber nicht abschaffen. Gemäss den Initianten wären Kleinbauern und Alpbetriebe von den Änderungen nicht betroffen, da sie keine «Massentierhaltung» betreiben. Diese könnten sich besser um Tiere kümmern, da bei kleineren Tierbeständen mehr Zeit für das einzeln Tier übrig bleibe. Betroffen von der Initiative wären nur die grossen industriellen «Fleischfabriken», heisst es auf der Website.
Die Initiative würde Kleinbauern die Chance ermöglichen, auf dem Markt zu bestehen und fairere Preise zu erzielen, indem Grossbetriebe mit immensen Tierbeständen diese reduzieren müssen, so die Vorstellung der Initianten.
Hinter dem Volksbegehren stehen Personen aus 15 Organisationen. Darunter ist etwa Vera Weber von der Fondation Franz Weber oder Vertreter von Greenpeace oder der Grünen Partei.
«Tierhaltung wie in der Werbung anstreben»
Der Rat lehnte die Initiative am Mittwoch jedoch mit 111 zu 60 Stimmen bei 19 Enthaltungen ab. Neben Teilen der SP und der GLP stellten sich die Grünen vollumfänglich hinter die Initiative. «Wenn wir als Menschen Tiere halten und essen, sind wir verantwortlich, dass wir ihnen ein dem Tierwohl entsprechendes Leben ermöglichen», sagte Meret Schneider (ZH), Mitinitiantin der Massentierhaltungsinitiative.
Ein Schwein sei bezüglich Empfindungsfähigkeit und kognitiver Leistungsfähigkeit einem Hund überlegen. Es möchte sich bewegen, spielen, sein Sozialverhalten ausleben, führt sie aus. «Dennoch sehen weniger als 50 Prozent der Schweine bis zu ihrem Schlachttag nie den freien Himmel, geschweige denn ein Schlammbad. Man stelle sich vor, wir würden heute Golden Retriever so halten, wie wir das mit unseren Schweinen tun», hielt sie fest.
Die Zürcherin kritisiert die Fleischwerbung. Diese würde ein Bild zeigen, das nicht existiere. Man können den Konsumierenden nicht verübeln, dass sie denken, den Schweinen und den Hühnern ginge es tatsächlich so, wie das in den Videos gezeigt wird. «Aber alle in diesen Werbungen präsentierten Betriebe würden den Anforderungen der Initiative entsprechen Wir sollten in Bezug auf die Bauern in den Videos endlich Taten folgen lassen und dafür sorgen, dass die Tierhaltung in der Schweiz tatsächlich so aussieht, wie es dort gezeigt wird», fordert Meret Schneider.
Ställe mit 27’000 Hühnern in der Schweiz
In der Debatte zeigte sich eine Diskrepanz im Verständnis darüber, wie die landwirtschaftliche Tierhaltung in der Schweiz aussieht. Die Initianten zielen auf die Massentierhaltung. «Nur 7 Prozent der Masthühner in der Schweiz sehen jemals die Sonne. Die anderen sind in ihrem kurzen Leben, in ihrem sehr kurzen Leben, in Masthallen von 12 000 oder mehr Tieren eingesperrt. Rund 4 Prozent aller Masthühner verenden schon vor dem Schlachthoftermin an Krankheiten oder an Schwäche», sagte Regula Rytz (Grüne/BE). Diese Situation habe nichts mit der Idylle zu tun, die die mit Steuergeldern bezahlte Fleisch- und Milchproduktewerbung heute verspreche.
Aus diesem Grund soll die Anzahl der Tiere pro Stall reduziert werden, forderten die Grünen. Für die Bäuerinnen und Bauern hätte das entsprechend grosse Folgen in der Infrastruktur. Die Initiative will den Landwirtschaftsbetrieben für die Umstellung der Infrastruktur 25 Jahre Zeit einräumen.
Tierhaltung mit Familienanschluss
Die SVP und die Mitte zeichneten demgegenüber das Bild der Tierhaltung «mit Familienanschluss». «In der Schweiz gibt es keine Massentierhaltung», betonte Landwirt Andreas Aebi (SVP/BE). Die meisten Betriebe beteiligten sich zudem bereits an Tierschutzprogrammen wie «Raus», bei welchem die Tiere regelmässigen Auslauf haben müssen. «77 Prozent der Betriebe beteiligen sich am sogenannten Raus-Programm, damit die Tiere hinauskönnen; 61 Prozent sind bei besonders tierfreundlichen Stallhaltungen dabei. Wo auf der Welt gibt es das? Nirgends. Ich habe da meine Erfahrungen», sagte Aebi im Rat. Die Initiative sei nicht nötig.
Kein Bauer und keine Bäuerin wolle zudem, dass es den Tieren schlecht gehe, sagte Aebi. «Wenn es meinen Tieren nicht gut geht, geht es mir überhaupt nicht gut.» Aebi erwähnte auch Zielkonflikte. «Ich denke hier an die Ammoniakemissionen aufgrund zusätzlicher Freilandhaltung, auch an Massnahmen im Raumplanungsgesetz. Eine einseitige, verstärkte Gewichtung des Tierwohls über die Verfassung müsste entweder zu einer einseitigen Gewichtung dieser anderen Interessen führen oder zu deren stärkeren Gewichtung via Bundesverfassung, und das ist auch kaum zielführend», mahnte er an.
SVP, Mitte und auch die FDP waren ausserdem der Meinung, dass die bestehenden Regelungen ausreichend für ein hohes Tierwohl sorgten. FDP-Sprecher Beat Walti (ZH) wies darauf hin, dass die Schweiz das einzige Land der Welt sei, das die Tierbestände pro Betrieb gesetzlich reguliere. Die Schweiz habe die strengsten Tierschutzregeln weltweit.
75 Kühe: «Ich bin Massentierhalter»
Auch Martin Haab (SVP/ZH) äusserte sich zu Initiative. Er sei seit vierzig Jahren leidenschaftlicher Viehzüchter und Milchbauer. «Zusammen mit meiner Familie halte ich heute 75 Kühe im Stall, ich bin also Massentierhalter. Dazu haben wir nochmals so viele weibliche Nachzucht. Also nochmals: Ich bin Massentierhalter», hielt er. Er führte aus, dass die Kühe nach den höchstmöglichen Tierwohlansprüchen unseres Gesetzes und unserer Landwirtschaftspolitik gehalten würden. «Ergänzend dazu haben wir viele weitere zusätzliche technische Annehmlichkeiten für unsere Ladys, wie zum Beispiel Melkmöglichkeit für jede Kuh rund um die Uhr, Futterangebot im Stall während 24 Stunden, dazu freier Zugang zur Weide während der Vegetationszeit», sagte er weiter.
Und er wies auch auf den Umstand hin, dass klein nicht automatisch gut heisse. «Als Milchkuh würde ich es vorziehen, eine von tausend in einem nach den neuesten Grundsätzen konzipierten Stall in den USA zu sein als eine von fünf in einem Kleinbetrieb in Rumänien, Bulgarien oder in den baltischen Staaten - notabene in einem dunklen Loch, welches dort "Stall" genannt wird», sagte der Landwirt. Diese Länder seien Teil der EU, die sich eines modernen Tierschutzgesetzes rühme. «Diese Initiative ist nicht nur völlig praxisfremd, nein, sie ist eine Diffamierung der professionellen Nutztierhalter», fuhr Haab fort.
Das «Dumping-Entrecôte aus Uruguay»
Die Diskussion drehte sich auch um billiges Importfleisch, das Bäuerinnen und Bauern unter Druck setzt. Martina Munz (SP/SH) etwa verwies auf ein «uruguayisches Dumping-Entrecôte», das ihr in einem Grossverteiler angeboten worden sei und «angeblich aus Weidehaltung» stamme. Das gehe nicht. Die Initiative verlangt daher auch Vorschriften für den Import von Tieren und tierischen Erzeugnissen.
Die Bevölkerung könne schon heute mit dem Griff zu Schweizer Bio-Produkten einen Kaufentscheid zugunsten besser hergestellten Produkten fällen – allerdings sei das Angebot leider grösser als die Nachfrage, sagten dazu etwa Leo Müller (Mitte/LU) und Marianne Binder (Mitte/AG). Es sei unehrlich, dass Bäuerinnen und Bauern für die «Träumereien» von besserem Tierwohl bei fehlender Akzeptanz für höhere Preise hinhalten müssten, sagte Manuel Strupler (SVP/TG).
«Initiative will Tierbestand reduzieren»
Die Initiative wolle den Tierbestand in der Schweiz reduzieren. «Gemäss Botschaft des Bundesrates heisst das beim Rindvieh minus 45’000 GVE. Für die meisten hier im Saal heisst das nicht viel. Aber wenn man das genauer betrachtet, entspricht das beim Rindvieh 112’000 Tieren, die ein oder zwei Jahre alt sind. 112 000 Stück Jungvieh fehlen nachher auf unseren Alpweiden. Nachher haben wir Alpen, die verganden», kritisiert Dettling.
Auch das Geflügel treffe es hart. Beim Geflügel sei in der Botschaft des Bundesrates eine Reduktion um 20’000 GVE ausgewiesen. «Als Folge müssten beispielsweise fünf Millionen zusätzliche Hühner importiert werden – aus Ländern mit Grossbetrieben», sagte Dettling. Er schliesst daraus, dass die Initiative auf Importe setze, was wiederum nicht dem Willen des Parlaments und der Bevölkerung entspreche.
Die Schweiz habe praktisch die tiefen Obergrenzen der Welt. «Bei den Kälbern maximal 300 Stück, bei den Schweinen maximal 1500 Stück, bei den Legehennen maximal 18 000 Stück. Das erscheint als viel. Aber wenn wir über die Grenze schauen, so gibt es in Deutschland Betriebe mit 600’000 Legehennen pro Betrieb», so Dettling.
«RAUS-Geld fällt weg»
Bei den Kühen würden in der Schweiz weniger als 1 Prozent in Betrieben mit Herden von mehr als 100 Stück gehalten. In Deutschland lebten 75 Prozent in Herden, die grösser als 100 Stück seien. Bei einer Annahme der Initiative werde es auch Auswirkungen auf die Raumplanung. «Mit der Initiative müssen wir dann aber 22’000 neue Gebäude ausserhalb der Bauzone errichten, damit wir überhaupt wieder das Niveau von heute erreichen», warnt Dettling.
Dettling äussert sich auch zum direkten Gegenentwurf: «Dieser sieht vor, dass das RAUS-Programm (regelmässig Auslauf im Freien) obligatorisch wird, und das macht vor allem den Bauern in den Berg- und Hügelregionen zu schaffen. Beim Rindvieh machen heute 87 Prozent der Bauern beim RAUS-Programm mit. Total sind dafür 300 Millionen Franken reserviert.» Wenn das Programm obligatorisch werde, dann falle dieses Geld weg. «Sie bestrafen damit die Bergbauern stark, weil der Bund die Beiträge nicht mehr bezahlt, wenn etwas obligatorisch wird», warnt Dettling.
Auch «minimalste Regeln» nicht in Verfassung
Auch dem Bundesrat geht die Initiative zu weit. Allerdings will er die tierfreundliche Unterbringung, den regelmässigen Auslauf und die schonende Schlachtung von Nutztieren mit einem Gegenentwurf in die Verfassung aufnehmen. Damit sichere der Bundesrat die «absolut minimalsten Grundregeln» in der Verfassung, sagte Samuel Bendahan (SP/VD). Der Rat lehnte das aber mit 107 zu 81 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Die Grünen, die SP und die GLP stimmten dafür.
Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag von Kilian Baumann (Grüne/BE), dem Volksbegehren einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Die Idee neuer Tierhaltungsregeln auf Gesetzesstufe erreichte nur die Ratslinke und die GLP – und wurde mit 106 zu 81 Stimmen verworfen.
Schliesslich blieb es trotz stundenlanger Debatte bei der Ablehnung sowohl der Initiative als auch jeglicher Alternativen dazu. Als nächstes debattiert der Ständerat darüber.
Wortlaut der Initiative
neu Art. 80a BV (Landwirtschaftliche Tierhaltung)
1 Der Bund schützt die Würde des Tieres in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Die Tierwürde umfasst den Anspruch, nicht in Massentierhaltung zu leben.
2 Massentierhaltung bezeichnet eine technisierte Tierhaltung in Grossbetrieben zur Gewinnung möglichst vieler tierischer Produkte, bei der das Tierwohl systematisch verletzt wird.
3 Der Bund legt die Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, den Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maximale Gruppengrösse je Stall fest.
4 Der Bund erlässt Vorschriften über den Import von Tieren und Tierprodukten zu Ernährungszwecken, die diesem Artikel Rechnung tragen. Art. 197 BV (Übergangsbestimmungen)neu Ziff. ### Die Ausführungsbestimmungen zur landwirtschaftlichen Tierhaltung gemäss Art. 80a BV können Übergangsfristen für die Transformation der landwirtschaftlichen Tierhaltung von maximal 25 Jahren vorsehen. Die Ausführungsgesetzgebung orientiert sich bezüglich Würde des Tiers an Bio Suisse Standards (mindestens Stand 2018). Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Art. 80a BV nach dessen Annahme nicht innert 3 Jahren in Kraft getreten, erlässt der Bundesrat Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg.



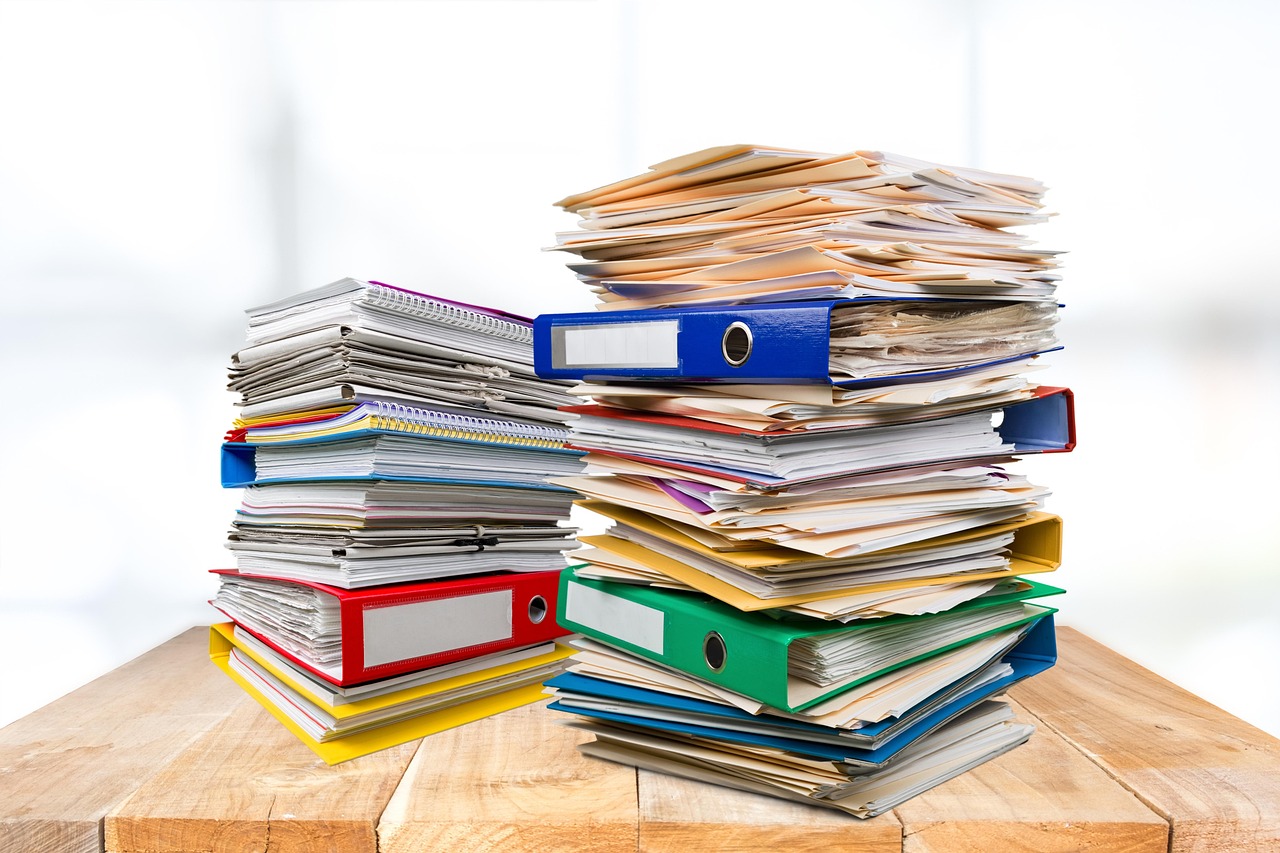
Kommentare (1)