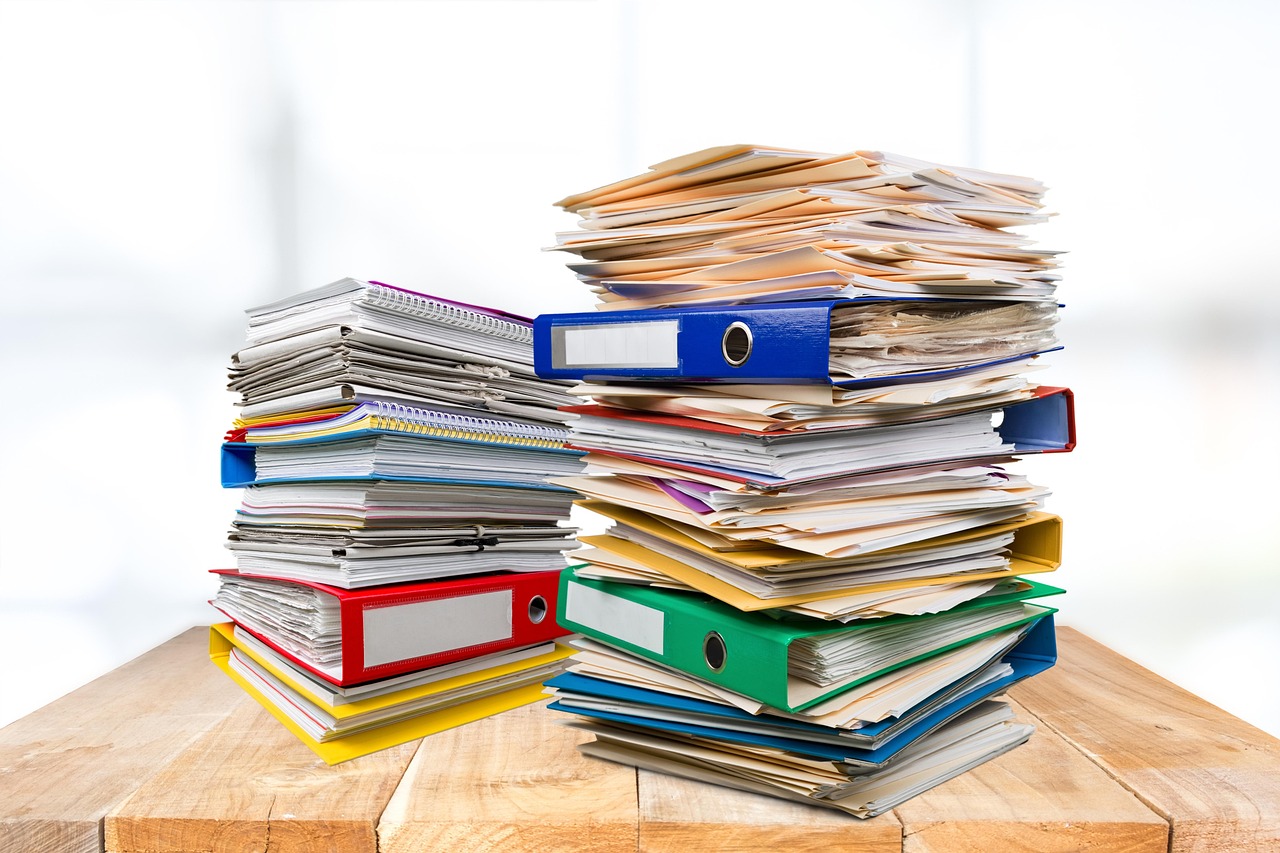Am Dienstag, 23. Mai 2023, stand die Besichtigung zweier kroatischer Betriebe auf ihrem Reiseprogramm: ein Rinderzuchtbetrieb in der Nähe von Porec HR und ein Wein-, Olivenöl- und Käseproduktionsbetrieb. Der Besuch eines Rinderzüchters stimmte die Teilnehmenden besonders nachdenklich.
Dieser Bericht wurde verfasst von Seraina Stenz, Nadine Walther, Christian Pfister und Anna Regula Vollenweider.
Zwei Welten in Istrien
Das Boskarin-Rind, eine istrische Rasse, gilt als eine der ältesten Rinderrassen Europas . Das Boskarin-Rind ist eine Dreinutzungsrasse und wurde vor allem als Zugtier verwendet.
Vor etwa 40 Jahren war die Rasse vom Aussterben bedroht. Durch staatliche Unterstützung wurde das Boskarin-Rind jedoch gerettet. Die Kühe sind durchschnittlich 138 cm gross, die Stiere 148 cm. In Ausnahmefällen werden die Stiere aber viel grösser. Die Verwandtschaft mit dem italienischen Grauvieh ist dem Boskarin-Rind anzusehen. Die Kälber werden dunkelgrau geboren. Und je älter sie werden, desto weisser wird ihr Fell.

Im Gespräch mit einem 85-jährigen Rinderzüchter nahe Porec. Er bewirtschaftet rund 130 ha, erwirtschaftet jedoch kaum Einkommen.
zvg
Schwere Boskarin-Ochsen
Auf dem Betrieb werden die Studierenden von einem 85-jährigen Landwirt, einer Ziege und drei Boskarin-Ochsen begrüsst. Die Ochsen sind der ganze Stolz des Landwirtes. Der älteste ist acht Jahre alt, riesig und wiegt ungefähr 1’500 Kilogramm. In Kroatien gibt es jedes Jahr eine Boskarin-Ausstellung mit drei verschiedenen Kategorien. Das schönste, das bravste und das schwerste Tier werden dabei gekürt. Unser Landwirt hat mit seinem Ochsen schon mehrmals den Sieg in der Kategorie des schwersten Tieres mit nach Hause nehmen können.
Neben seinen Ochsen besitzt der Landwirt noch 13 Pferde und 23 Kühe mit Kälbern. Er hat rund 30 Hektaren Eigenland, bewirtschaftet aber noch 100 Hektaren von anderen Landwirten. Diese für Schweizer Betriebe vergleichsweise grosse Fläche besteht vorwiegend aus Weiden und Buschlandschaften. Ackerbau betreibt der Landwirt einzig auf einer kleinen Parzelle direkt vor dem Hof. Darauf baut er Gerste für die Winterfütterung seiner Tiere an.
Die hierfür notwendigen Arbeiten werden jedoch durch einen benachbarten Lohnunternehmer durchgeführt. Der Landwirt selbst verfügt über keinen grossen Maschinenpark. An den Gebäuden wurden in den vergangenen Jahren kaum Investitionen vorgenommen. So machen diese einen etwas alten und heruntergekommenen Eindruck. Futter muss zudem teilweise unter freiem Himmel gelagert werden.

Mit Stolz zeigte uns der Landwirt zum Abschluss seine Pferdeherde. Diese verbringt sowohl Sommer als auch Winter vorwiegend auf der Weide.
zvg
Fehlende staatliche Unterstützung
In Kroatien gibt es im Gegensatz zur Schweiz sehr viel Land und nur noch sehr wenige Landwirte, die bereit sind, das Land zu bewirtschaften. Unser Landwirt erzählte uns frustriert, dass er früher, als die Boskarin-Rinder noch vom Aussterben bedroht waren, rund 500 Euro (etwa 482 Franken) pro Jahr und Rind vom Staat für die Erhaltung der Rasse bekommen hat. Heute bekommt er für die Rinder nichts mehr.
Der kroatische Staat unterstützt die Landwirtschaft kaum. 80 Prozent der Lebensmittel werden importiert. Viele Landwirte geben deshalb den Hof auf. Die Landwirtschaft in Kroatien ist unattraktiv. Auch der besuchte Landwirt schildert seine Erfahrungen. Sowohl sein Sohn als auch sein Enkel zeigten Interesse an einer Hofübernahme. Jedoch stellten sie rasch fest, dass mit einer Anstellung ein deutlich besseres Einkommen und damit ein höherer Lebensstandard möglich ist.
Einfacher Lebensstandard
Die schlachtreifen Ochsen verkauft der Landwirt an eine staatliche Firma, die istrische Spezialitäten produziert. Er bekommt rund 500 Euro pro Ochse (etwa 482 Franken). Dieses Unternehmen bezahlt aber meistens erst lange Zeit nach der Schlachtung. Aufgrund dieses tiefen landwirtschaftlichen Einkommens ist der Lebensstandard des Landwirtes sehr bescheiden. Die Kosten deckt er vorwiegend mittels der staatlichen Altersrente. Eine derartige Bewirtschaftung scheint in der Schweiz kaum vorstellbar.
Auch hierzulande sichern die Produktionserlöse das wirtschaftliche Überleben der Bäuerinnen und Bauern kaum. Jedoch leisten die staatlichen Direktzahlungen einen hohen Beitrag zum Erhalt der inländischen Produktion und des Selbstversorgungsgrades von rund 50 Prozent. Gefragt nach lukrativen Geldquellen in Istrien, nennt der Landwirt den Tourismus. Dieser stellt die Haupteinnahmen der Region dar. Aber auch da könne die Landwirtschaft nicht profitieren. Hotels würden hauptsächlich ausländische Fertigprodukte kaufen.
Fussfessel für Pferde
Die Studierenden durften noch kurz einen Blick auf die 13 Pferde des Landwirtes werfen, die er aus Liebe zum Tier hält. Diese sind im Sommer den ganzen Tag auf der Weide. Im Winter werden sie jeden Tag über eine Strecke von bis zu fünf Kilometern in den Stall getrieben. Vom Staat erhält er hier im Gegensatz zu den Rindern 500 Euro pro Tier (etwa 482 Franken). Auffällig war, dass alle erwachsenen Tiere Fussfesseln an den Vorderbeinen trugen.
Diese Fussfesseln haben in Kroatien Tradition und sollen die Tiere daran hindern, davonzulaufen. Dies erstaunt die Studierenden, denn in der Schweiz wären derartige Haltungsmassnahmen mit dem Tierschutzgesetz nicht möglich. Eine weitere Tierart, die der Staat finanziell unterstützt, sind Istrien-Ziege. Das Tier gilt als Nationaltier, da dank ihrer Milch während des 2. Weltkrieges viele Kinder in Kroatien überlebt haben.

Herzliche Begrüssung unserer Reisegruppe durch den Geschäftsführer des Lebensmittelunternehmens Agro Laguna. Im Anschluss folgte eine Degustation seiner istrischen Spezialitäten.
zvg
Wein, Olivenöl und Käse
Nach diesem ersten eindrücklichen, aber auch nachdenklich stimmenden Erlebnis des Tages ging es weiter zur Agro Laguna in Porec , wo der Besuch eines regionalen Lebensmittelverarbeiters auf dem Programm stand. Dessen Palette besteht aus drei Produkten: Wein, Olivenöl und Käse.
Die rund 1’200 Hektaren Reben, Olivenhaine und Grasflächen im Umkreis von 25 Kilometern werden von unter Vertrag stehenden Landwirtinnen und Landwirten bewirtschaftet, rund 40 Prozent davon biologisch. Das alpine und mediterrane Klima eignet sich für diese Kulturen besonders.
Parasit macht Oliven zu schaffen
Jährlich verzeichnet die Region mehr als 2’400 Sonnenstunden (ähnlich wie Tessin und Wallis), wird jedoch von extrem hohen Temperaturen verschont. Bei der Weinproduktion wird viel Wert auf Qualitätsstandards und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Dies bestätigen die 173 Goldmedaillen, die die Agro Laguna in den vergangenen Jahren an Wettbewerben gewonnen hat.
Sämtliche Trauben der insgesamt 15 angebauten Sorten werden im Herbst an den Unternehmenshauptsitz geliefert, von Hand sortiert und weiterverarbeitet. Das grösste Problem in Sachen Schädlingen stelle derzeit ein Parasit dar, der den Oliven den Saft aussauge, sodass anschliessend kaum mehr Öl gewonnen werden könne, sagte der Betriebsleiter. Bekämpft wird dieser mittels eines Hormonpapiers, das in den Olivenhaien aufgehängt wird.

Die vier durch die Reisegruppe degustieren Weine. Von Rosé über Weiss- und Rotwein sowie einen Muscat war alles dabei.
zvg
Spezialität Mischkäse
Ein weiteres, in der Schweiz eher selten vorkommendes Produkt ist ein Mischkäse aus Kuh- und Schafsmilch. Hierzulande wird dieser Käse teilweise im Tessin produziert, in Kroatien scheint dies jedoch ein etabliertes Milchprodukt zu sein. Dessen Geschmack ist äusserst fein, es hat gemäss den Studierenden kaum «geböckelt».

Während der Degustation verbesserte sich die Stimmung unserer Reisegruppe mit jeder weiteren Kostprobe. Zusätzlich konnte vorzüglicher Käse sowie Olivenöl degustiert werden.
zvg
So ging ein weiterer Tag unserer Abschlussreise mit vielen neuen Eindrücken zu Ende. Innert kürzester Zeit und Distanz tauchten die Studenten in zwei unterschiedliche Welten innerhalb des Landes Kroatien eintauchen.
Ein längst pensionierter, unter Armut leidender Landwirt, der über die staatlichen Missstände in der Landwirtschaft klagt, und ein erfolgreicher Geschäftsherr im Hemd, der über seine weltweit tätige Unternehmung schwärmt, bleiben in Erinnerung.
Weitere Folgen
Teil 1 der Reise: Mit 12 Kühen grösster Milchviehhalter