Beim Zwischenstopp in Bächli (SG) auf dem Betrieb Brandhof durfte ich einen besonderen Höhepunkt meiner Reise erleben – ein Treffen mit der Betriebsleiterfamilie Alder und mit dem bekannten «Kuhsignal-Spezialisten» Christian Manser. Vor Ort erfuhr ich, wie sie in Zusammenarbeit den alten Milchviehstall von Alders umstrukturiert haben.
Landwirten Augen öffnen
Die Zusammenarbeit von Christian Manser (55), dem «Kuh-Signal-Spezialisten», und der heutigen Betriebsleiterin Sarah Alder (39) aus Bächli (SG) begann bereits vor geraumer Zeit. Ihr Vater Heini Alder (68) knüpfte bereits vor 13 Jahren als einer der Pioniere den Kontakt zu Manser, der sich auf das Verhalten und das Wohlbefinden von Rindvieh spezialisiert hat. Genauer gesagt auf die Signale, die eine Kuh ausstrahlt, und deren Bedeutung. Diese Signale ermöglichen Rückschlüsse auf Optimierungsmöglichkeiten in der Haltung sowie Massnahmen zur Verbesserung, die im Stall vorgenommen werden können.
Christian Manser hat es sich zur Berufung gemacht, Landwirten die Augen zu öffnen und sie für die Bedürfnisse ihrer Tiere zu sensibilisieren. Durch die Deutung der Kuhsignale lassen sich Rückschlüsse auf das Wohlbefinden und auf die Gesundheit der Tiere ziehen, was Anstösse zu verbesserten Haltungsbedingungen geben kann. Gezielte Anpassungen im Stall, bei der Fütterung und bei der Betreuung führen dazu, dass das Leistungspotenzial der Tiere ausgeschöpft werden kann.
Wände einschlagen
Manser richtet sich dabei an das Prinzip der «sechs Weidefreiheiten», die er als Grundlage für eine tiergerechte Haltung entwickelt hat. Dabei bestünde enormes Optimierungspotenzial in bestehenden Anbinde- und Freilaufställen. «Es sind manchmal bereits kleine Massnahmen, die zu spürbar verbesserten Veränderungen führen», sagt er im Gespräch auf dem Hof. Oft genüge ein Anstoss bei den Landwirten, indem man ihnen helfe, das erste Fenster herauszunehmen oder die erste Wand zu durchbrechen. Sobald sie erkennen, wie viel Luft und Licht ein fehlendes Fenster bringt, sind sie motiviert, auch die restlichen zu entfernen.
Sechs Freiheiten bei der Weide
Ruhe und Raum
12 bis 14 Stunden Liegezeit braucht die Kuh über den Tag verteilt. Massgebend für häufige Ruhephasen sind genügend Schwungraum, passende Liegeboxenabtrennungen und die Griffigkeit der Liegeunterlage. Genügend Ausweichmöglichkeiten (keine Sackgassen) und eine gute Übersicht sind weitere Erfolgsfaktoren. Dazu gehören auch rutschfeste Böden, damit sich die Kuh sicher im Stall bewegen kann.
Luft und Licht
Frischluft ist gratis und sollte der Kuh immer zur Verfügung stehen. Dadurch kann die Kuh sich abkühlen und schlechte Stallluft wird aus dem Stall befördert. Massnahmen für mehr Luftzirkulation sind beispielsweise offene Seitenwände (natürliche Querlüftung) und mechanische Unterstützung durch Grossraumlüfter etc. Viel Tageslicht hat zudem einen positiven Einfluss auf die Gesundheit, den TS-Verzehr und die Leistung der Tiere.
Wasser und Futter
Eine laktierende Kuh trinkt abhängig von ihrer Ration und der Lufttemperatur zwischen 100 und 150 Litern Wasser pro Tag. Deshalb ist es naheliegend, dass ihr genügend frisches Wasser in übersichtlichen Tränken im Stall zur Verfügung stehen sollte. Im Optimalfall hat auch jede Kuh Zugang zu einem Fressplatz mit schmackhaftem Futter.
Auf dem Betrieb der Familie Alder hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Diese Veränderungen sind nicht zuletzt auf die Unterstützung von Manser bei der Planung des Umbaus des alten Milchviehstalls zurückzuführen. «Es braucht immer beide Seiten», erklärt Manser. «Die Landwirte müssen offen sein und auf mich zukommen wollen. Meistens sind es bereits die Lösungsorientierten, die nach Verbesserung streben.»
In Freilaufstall umgebaut
Oftmals sehe er hierbei bei den heutigen Betriebsstrukturen Konfliktpotenzial. «Es gibt zu viele Landwirte, die einen Stall voll Kühe haben, mit fehlendem Interesse und fehlender Vorliebe für die Tiere», so Manser. Was hart klingt, bestätigt sich mit seiner weiteren Erklärung jedoch: «Ich kenne einige Landwirte, die einen Stall voll Kühe haben, jedoch gar keine Freude daran.» Manchmal übernähmen junge Landwirte die Betriebe als Nachfolger ohne dieselben Interessen zu teilen wie ihre Eltern.
So war es anders bei Sarah Alder. Sie hat nach der Betriebsübernahme beschlossen, den alten Anbindestall, der 1989 gebaut wurde, in einen Freilaufstall für 14 Mutterkühe inklusive Kälber umzubauen. «Das Melken hat mir immer Freude bereitet», so Sarah. «Trotzdem war mir bewusst, dass ich etwas ändern muss, um das Wohlbefinden der Tiere zu verbessern und zukunftsorientiert zu handeln.» Bereits im Milchviehstall wurden die Fenster rausgerissen, um mehr Luft und Licht in den Stall zu bringen. Zugleich war Heini einer der ersten Landwirte, der auf die Kalk-Stroh-Matratze umstellte. Und das sogar in einem Biobetrieb.
Offen und lichtdurchflutet
In Zusammenarbeit mit ihrem Vater Heini und Christian Manser entschied sich Sarah schliesslich für eine Umgestaltung des bestehenden Gebäudes. «Es muss nicht immer ein Neubau sein. Oft gibt es viele gute Möglichkeiten, einen bestehenden Stall neu auszurichten», betont Manser. Heute halten die Alders ihre Pinzgauer-Mutterkühe im selben Gebäude wie damals die Milchkühe, jedoch unter deutlich besseren Bedingungen: mehr Licht, mehr Raum, bessere Durchlüftung, ein Brunnen als Tränke und ein automatisiertes Futterband zur Futtervorlage.

Sarah Alder und ihr Vater Heini haben ihren Stall laufend verbessert.
Michelle Wüthrich
Der heutige Kaltstall bietet den Kühen Freilauf, ist offen und lichtdurchflutet. Es liegt nicht einmal der typische Stallgeruch in der Luft. Die Seiten sind geöffnet, und der Boden besteht aus Beton, wobei sich zentral die Liegeboxen der Kühe befinden. Direkt in der Mitte, aber separiert durch Spannsets anstelle von starren Eisenrohren, befindet sich eine grosszügige Liegefläche für die Kälber.
Arbeitseffizienz und «Tierwohl»
Beim Umbau standen die Themen Arbeitseffizienz und «Tierwohl» im Vordergrund. Und damit eben die «sechs Freiheiten der Weide». «Die Kuh ist für die Weide geboren und findet dort sechs Freiheiten, die wir im Stall umgesetzt haben», erklärt Sarah und ergänzt das Resultat: «Die Kühe sind sehr zufrieden, sie sind ruhig und gelassen, ihr Fell glänzt, und wir benötigen praktisch nie einen Tierarzt auf dem Hof.»
So mache es Freude. Auch Manser zeigt sich erfreut: «Es gibt nichts Schöneres als gesunde Kühe in einem Stall mit frischer Luft und viel Licht.»
-> Mehr zum Brandhof-Alder gibt es hier
Einen Einblick in den Hof der Familie Alder gibt es in diesem Video
Michelle unterwegs: Alle Etappen zum Nachlesen
1. Etappe: Matschige Stiefel und Kinderlachen
2. Etappe: Von der Chrüterei, zum Bier bis zum Käse
3. Etappe: Die Toggenburger Geheimweg-Etappe
Mit der Herzroute das ursprüngliche Toggenburg erkunden, geheime Talschaften entdecken und genussvoll um 99 Hügelkreten kurven. Das Toggenburg war seit jeher eine gäche und verkannte Landschaft, arm und zerfurcht, aber umso romantischer und geeigneter für unsere Eskapaden auf dem Elektrovelo. Schon kurz nach Herisau nestelt man sich wunderbar ins üppige Grün hinein, das hier alles überzieht, von der schroffen Felsschlucht bis zum lauschigen Hügelzug mit Blick bis zum Bodensee.
Dabei passiert man bald einmal die Grenze ins Sanktgallische hinein, was aber kaum spürbar ist. Der kompakte, appenzellisch anmutende Haustyp bleibt sich gleich, die Hänge steil und die Menschen zurückhaltend, aber herzlich. Erst in Lütisburg bekommt man die Thur zu sehen, die das Toggenburg geformt hat, quert sie auf einer alten Holzbrücke und darf dann wieder ins Unterholz der Vegetation verschwinden. Über kaum bekannte Orte und Gräben mäandriert man durch dieses ursprüngliche und kaum bekannte Tal und sieht sich mehr als einmal in die Vergangenheit zurückversetzt. Ganz zum Schluss winkt die kleine Stadt Lichtensteig vom Felssporn über der Thur, und wir gleiten genussvoll ins emsige Wattwil hinein, Hotspot des toggenburgischen Lebens.
Streckenbeschrieb: Herisau-Wattwil 55 km, 875 Hm, sehr hügelig.

3. Etappe Herisau-Wattwil
Herzroute







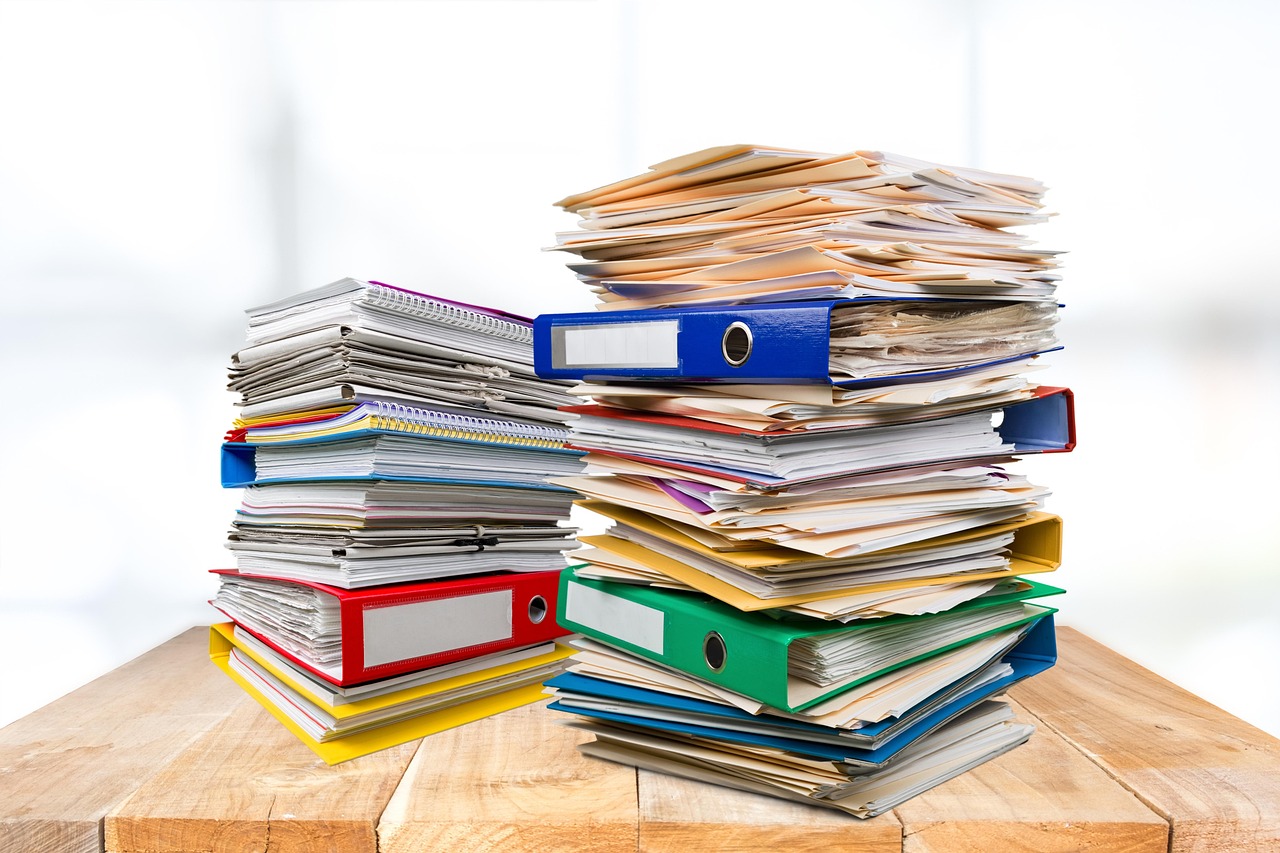
Kommentare (1)